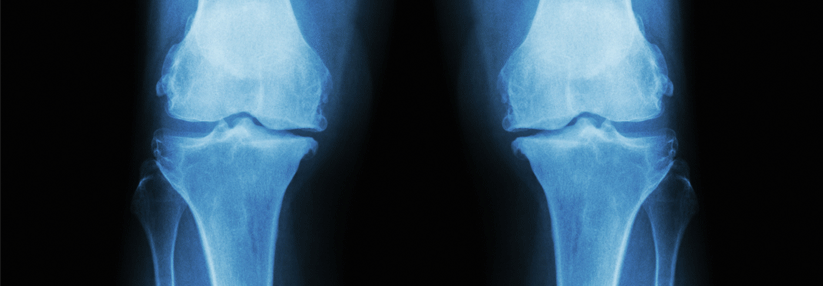
„Kardiologische Reha kann auch schaden“
 Angesichts besserer Medikamente und spezieller Apps sei eine Reha heute nicht mehr zwingend nötig.
© iStock/Hazal Ak
Angesichts besserer Medikamente und spezieller Apps sei eine Reha heute nicht mehr zwingend nötig.
© iStock/Hazal Ak
Schwere Aufgabe für Professor Dr. Simon Stewart von der Torrens University in Adalaide, Australien. In einer Pro-Kontra-Debatte musste er gegen ein Auditorium argumentieren, das von Sinn und Effektivität der kardiologischen Rehabilitation fest überzeugt war. Sein Kontrahent und Fürsprecher der Maßnahme, Professor Dr. Paul Dendale vom Heart Centre Hasselt in Belgien, hatte sich bereits auf diverse Studien berufen, die u.a. belegen: Rehaprogramme reduzieren die kardiovaskuläre Mortalität, senken die Rehospitalisierungsrate, verbessern die Lebensqualität und sind kosteneffektiv.
Das Angebot für Patienten umfasst heutzutage ein multidisziplinäres Paket, z.B. mit Sport, Lebensstilberatung, Rauchentwöhnung und psychosozialen Interventionen. Doch „mit Ausnahme des körperlichen Trainings wurde ein Großteil der Reha bereits durch Pharmakotherapie, Social Media und Internet ersetzt“, provozierte Prof. Stewart. Die wichtigsten präventiven Medikamente wie Lipid- und Blutdrucksenker gebe es in günstigen Pillen.
Sogar die Leitlinienautoren scheinen von entsprechenden Programmen nicht 100%ig überzeugt. In der aktuellen ESC-Guideline zum akuten Koronarsyndrom (ACS) ist die Teilnahme nur mit einer IIa-Empfehlung versehen, also mit einem „sollte erwogen werden“. Nach jahrzentelanger Erfahrung in der Therapie des ACS steht die kardiologische Reha für den australischen Kollegen damit auf wackeligen Evidenzsäulen.
Hinzu kommt: Gerade einmal jeder Dritte unterzieht sich der Tertiärprävention, wie eine Langzeitbefragung von Patienten mit stattgehabtem Myokardinfarkt ergab. Daran hatte sich auch im Verlauf von zehn Jahren kaum etwas geändert. Und wenn Betroffene mitmachten, so waren es nicht etwa Raucher oder unsichere Herzkranke, sondern die ohnehin schon Verantwortungsbewussten. „Reha begünstigt Patienten, die sie am wenigsten brauchen, und verliert diejenigen, die sie am meisten benötigen“, fasste Prof. Stewarts zusammen.
Fokus auf Komorbiditäten fördert „klinische Kaskade“
Unter diesem Gesichtspunkt stellte er außerdem die Kosteneffektivität infrage. Ökonomische Analysen würden fast nie die geringe Partizipation berücksichtigen. Es fehle schlicht die wichtige Intention-to-treat-Auswertung.
Will sich die Kardio-Reha im 21. Jahrhundert behaupten, muss sie sich an die veränderte Patientenlandschaft anpassen. Der Erfolg der modernen Infarkttherapie hat eine große Kohorte geschaffen, die mit Herzinsuffizienz oder Vorhofflimmern herumläuft. Zudem sorgen metabolische Erkrankungen und Adipositas dafür, dass die Raten einer akuten Koronarischämie unter Jüngeren (≤ 59 Jahre) zunehmen, während sie bei Älteren eher zurückgehen, erklärte der Referent. Dabei bezog er sich auf eine Kohortenstudie aus Japan, in der die Inzidenz von 1985 bis 2014 erfasst worden war.
Ein weiteres Problem bringt die zunehmende Multimorbidität mit sich. Programme, die komorbide Leiden stark adressieren, unterstützen womöglich die „klinische Kaskade“. Das bedeutet: Je mehr man komplex Kranke untersucht, desto mehr findet man. Und je mehr man findet, desto mehr sieht man sich gezwungen, etwas zu tun. „Aber genau das führt gewöhnlich zu schlechteren Outcomes“, warnte Prof. Stewart. Der Experte konnte den negativen Effekt bei hohem Komorbiditätsscore in einer eigenen Untersuchung bestätigen. „Die kardiologische Rehabilitation kann also auch schaden.“
Ein zeitgemäßes Konzept muss deshalb sicherstellen, dass
- es relevant bleibt für die sich entwickelnde Patientenklientel und die Outcomes,
- es neue medizinische Gefahren erkennt und sich daran anpasst,
- es durch robuste Daten gestützt wird,
- es mehr Kranke miteinbezieht, die tatsächlich profitieren würden (das sind nicht unbedingt diejenigen, die sich eine Smartwatch leisten können) und
- die Kandidaten den Nutzen der Maßnahmen erkennen.
Letztlich geht es Prof. Stewart nicht um ja oder nein, sondern um den steten Progress hin zu mehr Personalisierung.
Quelle: ESC* Congress 2019
* European Society of Cardiology





