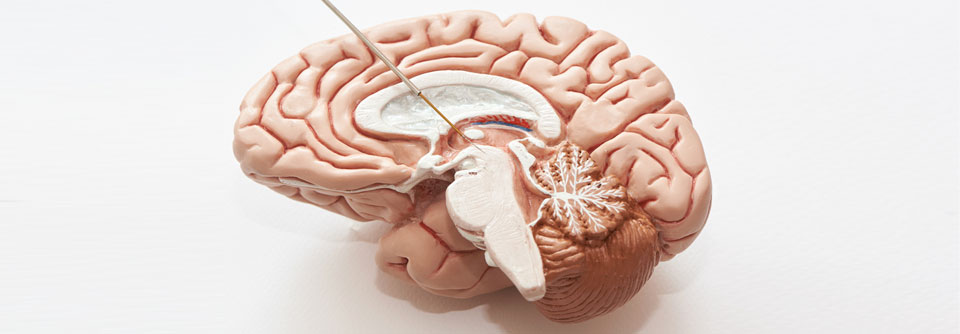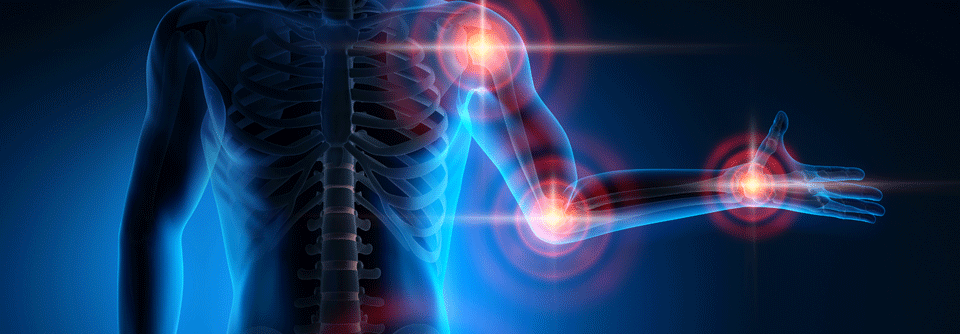Mit dem Placeboeffekt chronische Schmerzen lindern
 Placebos wirken, indem das Gehirn verunsichert wird.
© iStock/microgen
Placebos wirken, indem das Gehirn verunsichert wird.
© iStock/microgen
Placeboeffekte werden abseits klinischer Studien meist als Wirkkomponente medikamentöser oder anderer Interventionen genutzt. Mitunter steuern sie sogar den größten Teil zum Effekt bei. Bei chronischen Schmerzen, z.B. von Arthrosepatienten macht der Placeboeffekt bis zu 75 % der Medikamentenwirkung aus. Mit einem guten Draht zum Patienten können Sie diese Antwort noch verstärken, schreiben Professor Dr. Ted J. Kaptchuk von der Harvard Medical School in Boston und Koautoren. Inzwischen hat man auch eine recht gute Vorstellung davon, wie diese Wirkung zustande kommt. Stichwort: zentrale Sensitivierung.
Eine nachvollziehbare Erklärung liefert die Theorie, dass das Gehirn Stimuli statistisch anhand von Vorhersagemodellen filtert (s. Kasten). Bei Patienten mit chronifizierten Schmerzen wird somit unterbewusst am bestehenden Modell „Schmerz“ festgehalten und werden zum Beispiel Informationen hinsichtlich einer Heilung als Rauschen eingestuft und ignoriert oder das eingehende schwächere Schmerzsignal wird amplifiziert.
Zentrale Sensitivierung: Wenn der empfundene Schmerz nicht dem tatsächlichen entspricht
- die Vorhersage gemäß der neuen Signale anzupassen,
- die Gewichtung des Signals abzuschwächen und so den Fehler zu unterdrücken,
- das Signal so zu verstärken, dass es der Vorhersage weiterhin entspricht.
Scheinmedikamente eignen sich auch für die Diagnostik
Bemerkt es den Irrtum, passt es das Vorhersagemodell an, was den Teufelskreis durchbrechen kann und eine neue – spezifische – Behandlung ermöglicht. Da diese Prozesse unterbewusst ablaufen, lässt sich sogar bei offenen Verordnungen die entsprechende Placeboantwort erreichen, erklären die Autoren. Heimlich werden Placebos von Ärzten nur noch selten verordnet – in den USA beispielsweise von weniger als 4 %. Unter ethischen Gesichtspunkten lässt sich der verdeckte Einsatz reiner Scheinmedikamente auch nur schwer rechtfertigen. Die Anwendung von Pseudoplacebos ist ethisch ebenfalls problematisch, weil sie den therapeutischen Maximen von Transparenz und Einverständnis des Patienten oft zuwiderläuft. Pseudo bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Medikamente oder Supplemente verschrieben werden, die (vermutlich) keinen spezifischen Effekt auf die pathophysiologische Situation haben. Dazu zählt das Antikonvulsivum Phenytoin bei chronischen Schmerzen oder Magnesium gegen Cephalgien. In einer US-Studie berichteten allerdings mehr als 50 % der befragten Internisten und Rheumatologen, solche Pseodoplacebos zu nutzen. In Europa fanden sich teilweise sogar höhere Anteile. Nach wie vor setzen manche Ärzte Scheininterventionen zu diagnostischen Zwecken ein, um festzustellen, ob geschilderte Schmerzen psychogen sind oder Patienten beim Schweregrad übertreiben. Mit einer Placeboinjektion lässt sich z.B. testen, ob jemand für eine Denervation der Facettengelenke infrage käme: Zeigt das Placebo Wirkung, wird eine richtige Therapie oft verweigert. Doch solche Tests liefern im Allgemeinen keine Informationen zur Genese bzw. Stärke des Schmerzes und sind mit einer ausführlichen Patienteninformation kaum vereinbar. Inzwischen werden sie von den meisten Fachgesellschaften abgelehnt. Als ethisch vertretbar gilt dagegen der offene Einsatz von Placebos bei chronischen Schmerzen. Dieser erfolgt meist als Add-on zu einer nicht ausreichend wirksamen Standardtherapie und bietet die Aussicht auf einen erheblichen Zusatznutzen, schreiben die Autoren. Transparenz und Respekt vor dem Patienten sind hier kein Problem, weil der Patient adäquat aufgeklärt werden kann. Die American Medical Association stuft beispielsweise die offene Placebotherapie als erlaubt ein, wenn der Patient seine generelle Zustimmung erteilt hat. Umfragen haben ergeben, dass viele Kranke eine vom Arzt empfohlene offene Placebotherapie probieren würden.Keine Wunderheilung versprechen
Bei der Aufklärung können Sie (je nach Datenlage) z.B. sagen, dass (doppelt) verblindete Studien einen Placeboeffekt gezeigt haben, aber evtl. der Nutzen bei offener Anwendung noch unklar ist. Dabei sollten Sie nie eine Wirkung behaupten, sondern zu ihrer Unsicherheit stehen (ausprobieren, was passiert). Abseits der ärztlichen Praxis ist die medizinische Forschung ein wichtiges Einsatzfeld für Placebos: In randomisierten kontrollierten Studien kann man auf den verdeckten Einsatz von Scheinmedikamenten bzw.-interventionen nicht verzichten. Er gilt als ethisch vertretbar, wenn der Patient entsprechend aufgeklärt wurde und ihm durch eine ggf. verspätete Verumbehandlung kein wesentlicher Schaden droht. Auch Laborstudien etwa zum akuten nozizeptiven Schmerz lassen sich oft nur mit nicht offen deklarierten Placebos durchführen. Die Kollegen empfehlen in diesen Fällen, den Patienten über die Verblindung der Medikation während der Therapie aufzuklären. Beim Schlussgespräch sollte die Behandlung offengelegt werden und der Patient die Gelegenheit erhalten, seine Daten zurückzuziehen.Quelle: Kaptchuk TJ et al. BMJ 2020; 370: m1668; DOI: 10.1136/bmj.m1668