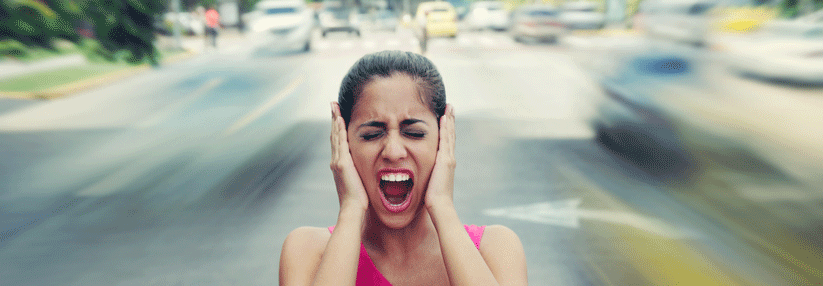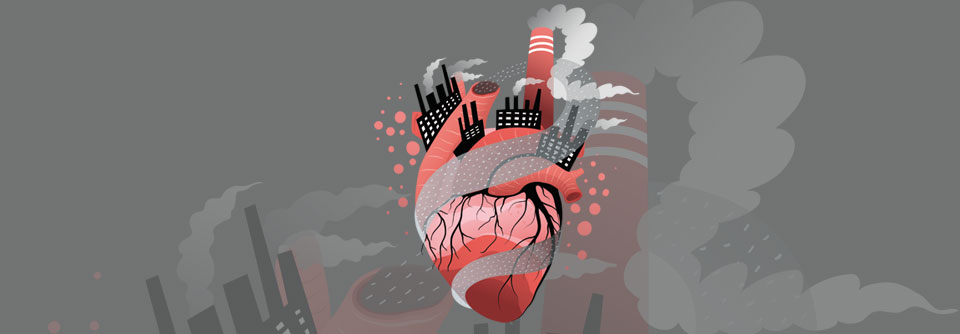Verkehrslärm und Luftschadstoffe fördern psychische Erkrankungen
 Ständiger Krach, Feinstaub, Kohlenstoffdioxid und Ozon sind laut den Forschern Auslöser psychischer und mentaler Störungen.
© iStock/fotoVoyager
Ständiger Krach, Feinstaub, Kohlenstoffdioxid und Ozon sind laut den Forschern Auslöser psychischer und mentaler Störungen.
© iStock/fotoVoyager
Verkehrsgetöse und schmutzige Umgebungsluft sind bedeutsame Umweltrisikofaktoren – da sind sich die Wissenschaftler einig. Bisher seien es in erster Linie Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems wie Myokardinfarkt und Schlaganfall gewesen, die man in diesem Zusammenhang untersucht hätte, schreiben Dr. Omar Hahad vom Zentrum für Kardiologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Kollegen. Man müsse den Blick aber deutlich weiter fassen und dürfe nicht nur die kardiovaskulären und zerebrovaskulären Erkrankungen mit einem dauerhaft lauten Umfeld und Luftschadstoffen in Verbindung bringen. Denn ständiger Krach sowie Feinstaub, Kohlenstoffdioxid und Ozon seien auch Auslöser psychischer und mentaler Störungen.
Die Autoren haben die einschlägigen medizinischen Datenbanken durchsucht und den aktuellen Wissensstand hinsichtlich der psychischen Folgen von Lärm und Luftverschmutzung zusammengefasst.
So geht die Umwelt auf die Nerven
Das Risiko korreliert mit der Feinstaubkonzentration
In die Luft geblasener Feinstaub steigert womöglich ebenfalls das Risiko für Depressionen, Angststörungen, Psychosen und Suizide. Auch hierbei scheint eine positive Korrelation zu bestehen: je höher die Feinstaubkonzentration der Umgebung, desto größer das Erkrankungsrisiko. Insgesamt sei die Aussagekraft ihrer Übersichtsarbeit mit Vorsicht zu genießen, schreiben die Wissenschaftler abschließend. Denn die Metaanalysen, Reviews und Primärstudien, die sie für ihre Auswertung herangezogen hätten, seien in der Methodik sehr verschieden, die Resultate daher schwer miteinander zu vergleichen. Bei den meisten Publikationen zu diesem Thema handele es sich zudem um Querschnittsstudien mit heterogenen Ergebnissen bei teils geringer Studienqualität. Deshalb ihre dringende Forderung: Längsschnittuntersuchungen seien mehr als überfällig, um die Gefahren von Umgebungslärm und -dreck für die Psyche beurteilen zu können.Quelle: Hahad O et al. Dtsch Med Wochenschr 2020; 145: 1701-1707; DOI: 10.1055/a-1201-2155