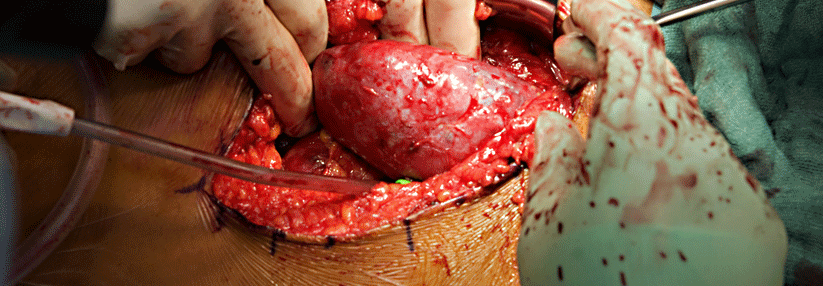Erste Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge
„Theoretische Vorlesungen brauchen wir nicht, sondern konkrete Vorschläge, wie wir die Probleme handhaben sollen,“ protestierte ein Kollege und unterbrach damit Ulrike Schneck, niedergelassene Diplom-Psychologin und Fachberaterin für Psychotraumatologie in Tübingen, die über das Trauma-Thema referierte.
Die Referentin reagierte professionell und flexibel. Sie beendete ihren Vortrag und schuf Raum für eine lebendige und spannende Diskussion unter den Frontkämpfern.
In der aktuellen Situation – große Sammelunterkünfte und begrenzte Ressourcen – werden wir nicht Herr der Lage und rekrutieren sogar Kollegen im Ruhestand, schilderte der Hausarzt, der die Referentin unterbrochen hatte, seine Not.
Traumatisierungssymptome vertagt |
Ein Arzt aus Esslingen, selbst mit Migrationshintergrund, der Flüchtlinge betreut, bemerkte, dass sich psychische Auffälligkeiten oft erst mit Verzögerung einstellen. Anfangs fielen ihm bei 1 % der Unterkunftsbewohner psychische Probleme auf, nach drei Monaten Aufenthalt jedoch bei sage und schreibe 40 %. Bürokratie, auseinandergerissene Familien, zermürbende Aufnahmeprozedur, Angst um das Aufenthaltsrecht stellen eine hohe Belastung dar. Daraus resultiert die sogenannte sekundäre Traumatisierung, bestätigte Dr. Soeder, weshalb es vielen Flüchtlingen zwei Monate nach ihrer Ankunft wesentlich schlechter geht. |
Ohne Ehrenamtliche, die helfen, z.B. Dolmetscher zu finden, gehe gar nichts. „Wenn Ihnen ein Traumatisierter berichtet, er werde von Mitbewohnern geschlagen, wenn er im Schlaf schreit, sind Sie ganz schön aufgeschmissen; und in der Psychiatrie bekommen Sie einen solchen Patienten auch nicht unter,“ so der Mediziner.
Gute Erfahrungen mit Sprechstunde vor Ort
Doch selbst wenn es um weniger schwer Traumatisierte geht, resultieren im Alltag der Hausarztpraxis oft riesige Probleme. Viele Menschen aus anderen Kulturen seien es nicht gewohnt, Termine einzuhalten, klagte ein anderer Zuhörer.
Dann kommen sie oft in größeren Gruppen und „bevölkern“ das Wartezimmer. Und schließlich gelingt es meist nicht, sich zufriedenstellend zu verständigen, da entweder gar kein Dolmetscher oder nur ein sehr schlechter zur Verfügung steht.
„Wir sind total überfordert“, pflichteten einige Seminarteilnehmer bei. Ein süddeutscher Allgemeinarzt appellierte dagegen an seine Mitstreiter, weniger zu klagen und konstruktive Lösungen zu suchen.
„Die Versorgung der Flüchtlinge kann man mit guter Organisation schon bewältigen.“ Das für seinen Kreis zuständige Gesundheitsamt habe innerhalb von vier Wochen in der Unterkunft eine „Sprechstunde vor Ort“ organisiert. „Damit vermeiden Sie Terminprobleme und haben auch nicht die Großfamilie im Wartezimmer sitzen.“ Zudem sei es vor Ort leichter, einen jeweils passenden Dolmetscher verfügbar zu halten.
Einfach auf Verdacht ein Antidepressivum geben?
Die Sprechstunde vor Ort bewähre sich gerade hinsichtlich der psychosozialen Versorgung: „Ein großer Vorteil besteht in der Kontinuität der therapeutischen Beziehung. Da kann sich im Verlauf von drei Wochen selbst in Drei- bis Fünf-Minuten-Kontakten etwas entwickeln.“
Und was tut dieser Kollege konkret bei akuten psychischen Problemen? Gezielt nach PTBS-Kriterien fragen, so die Antwort, und im Bedarfsfall auch Psychopharmaka einsetzen. Er habe gute Erfahrungen mit Duloxetin gemacht.
Kopfschmerzen, Somatisierungen, fehlende Verarbeitung traumatischer Erlebnisse – den Leuten gehe es rasch deutlich besser: „Das ist natürlich off label, aber wenn Sie wollen, können Sie eine Depressions-Diagnose dazu stricken.“
Ein anderer Anwesender aus dem Auditorium propagierte pragmatischen Optimismus: „Wir leisten doch im Rahmen der Möglichkeiten einen super Job. Wir haben keine optimalen Bedingungen, oft keine geeigneten Dolmetscher. Aber wir zeigen den Patienten, wir sind für sie da. Da müssen wir uns auch mal auf die Schulter klopfen!“
In zehn Jahren werde sich vielleicht der ein oder andere Flüchtling erinnern, dass da ein freundlicher Doktor war, der ihn untersucht und ernst genommen hat.
Ein Seminarteilnehmer fühlt sich durch die ganze Situation an ärztliche Arbeit in der Dritten Welt oder seine Erfahrungen aus der Bundeswehrzeit erinnert: „Wir müssen unsere Grenzen erkennen und akzeptieren. Ich tue, was ich kann, ich bin als Mensch und Arzt greifbar und vorhanden.“
„Gibt es Vorgaben für eine Triage, für wen dieser vielen Traumatisierten die Behandlung am wichtigsten ist?“, lautete eine weitere Frage an die Referenten.
Fälle mit Fremd- oder Selbstgefährdung sowie schwere Erregungszustände haben natürlich Vorrang, sagte Dr. Thomas Soeder, niedergelassener Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Tübingen. Spezifische Regeln für Flüchtlinge existieren aber nicht.
Selbst Psychiater fühlen sich hilflos
Warum erfolgt bei den Traumatisierten keine Gruppentherapie bzw. eine Behandlung mit konfrontativen Verfahren, fragte eine Zuhörerin. So weit sei man aktuell noch nicht, erklärte Ulrike Schneck. Sie würde aktuell auch stabilisierende Verfahren bevorzugen.
Gruppentherapeutische Konzepte seien in der Entwicklung. Insgesamt bestehen offenbar große regionale Unterschiede in der Organisation der ärztlichen Versorgung, wie die Diskussion zeigte.
Und eklatante Unterschiede in der Gemütslage der versorgenden Hausärzte – von verzweifelt überfordert bis optimistisch zupackend. Dass sich selbst Seelen-Fachleute mit der Welle der Traumatisierten überfordert fühlen, zeigte ein Gespräch im Anschluss an das Seminar.
Eine Psychiaterin bekannte gegenüber Medical Tribune: „Wir sind alle angeschrieben worden, Sprechzeiten für traumatisierte Flüchtlinge anzubieten. Aber ich besitze keine Erfahrung mit Traumaarbeit und deshalb habe ich mich nicht gemeldet.“
Schreiben Sie uns! |
Welche Erfahrung haben Sie in ihrem Versorgungsgebiet gemacht? Wie funktioniert die ärztliche Betreuung von Flüchtlingen allgemein, und die psychologisch-ärztliche speziell? |
Quelle: 51. Ärztekongress der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg