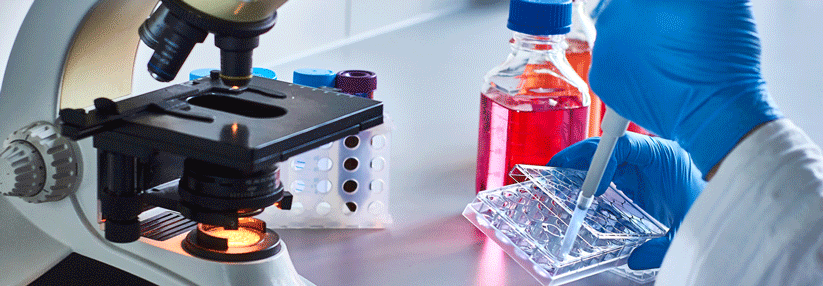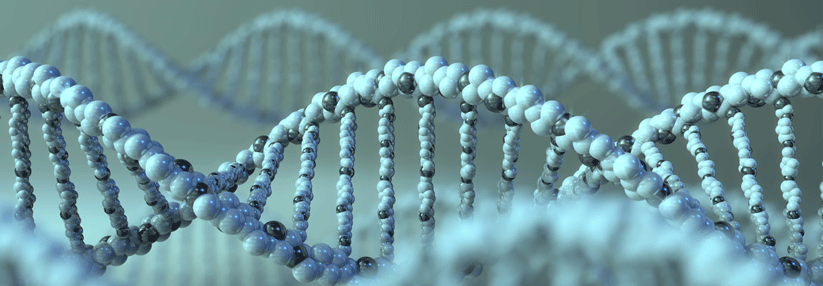Patientenwünsche werden in der Forschung unzureichend erfasst
 Lebensqualität ist für Krebspatienten ein entscheidendes Therapiekriterium.
© istock/FatCamera
Lebensqualität ist für Krebspatienten ein entscheidendes Therapiekriterium.
© istock/FatCamera
Professor Dr. Diana Lüftner, Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO), kennt die unterschiedlichen Sichtweisen des Klinikers und der Patienten. Der Arzt sieht demnach das progressionsfreie Überleben und die Zeit bis zur Chemotherapie als Endpunkt, er beobachtet über die Progression hinaus und sucht nach Bestätigung in Registern. Der Patient hat vor allem seine Lebensqualität im Blick.
Viele Patienten nähmen eine Lebenszeitverkürzung in Kauf, wenn ihnen dadurch Klinikaufenthalt oder Rollstuhl erspart bleibe, so Prof. Lüftner, zugleich Krebsspezialistin an der Berliner Charité. Selbst Patienten mit hoher Tumorlast erklärten, dass es ihnen gut gehe. „Stellen wird da noch die richtigen Fragen?“, sagte die Onkologin und zeigte auf Befragungsbogen, vor 25 Jahren entwickelt und inzwischen „verstaubt oder zumindest ergänzungsbedürftig“.
Beim progressionsfreien Überleben (PFS) gebe es heute deutliche Unterschiede von 25, 27, 30 Monaten. „Dies haben wir nicht mit Survival Benefit verbunden.“ Erforderlich ist deshalb aus ihrer Sicht eine neue Betrachtung der Endpunktparameter zur Gewinnung von Daten zur Quality of Life (QoL) – sowohl hinsichtlich der Selbstverwirklichungswelt der Patienten als auch der Performance im Alltagsleben.
Ärzte wissen oft gar nicht, „wie Patienten ticken“
Dies bekräftigte Professor Dr. Bernhard Wörmann, Medizinischer Leiter der DGHO. Patientenbezogene Endpunkte seien für einen 25-Jährigen anders als für einen 85-Jährigen. „Ich glaube, dass wir heute Verordnern Ergebnisse aus Studien dazu anbieten müssen“, sagte der Tumorspezialist. Und die Behandlung sei danach anzupassen, was wichtig für den Patienten ist. Grundsätzlich müsse man aber auch mit Datenunsicherheiten leben, wenn man eine frühe Zulassung von Medikamenten wolle, so Prof. Wörmann. Er sagte dies mit Blick auf die Nutzenbewertungen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), von denen Krebsmedikamente mit bisher knapp 140 Verfahren besonders betroffen sind.
„Zusatznutzen nicht belegt“, heißt es oft, weil Daten nicht erhoben oder Studiendaten nicht aussagekräftig sind. Die Kategorie „Zusatznutzen nicht belegt“ müsse mit Hinweis auf methodische Probleme und fehlende Daten differenziert werden, forderte der DGHO-Vertreter. Eine höhere Datensicherheit würde zudem durch zusätzliche Studien und Register erreicht sowie durch eine längere Nachbeobachtung und späte Nutzenbewertung. PD Dr. Stefan Lange, stellv. Leiter des Instituts für Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen verwies hierzu darauf, dass der G-BA bei der Nutzenbewertung jetzt auch Anwendungsbeobachtungen, Fall-Kontroll-Studien oder Registerstudien einfordern kann.
Shared-Decision-Making schon bei Studienplanung
Ralf Rambach, Vorstandsmitglied der Deutsche Leukämie- und Lymphom Hilfe e.V., machte an Folien in Spiegelschrift deutlich, dass Patienten oft nicht verstehen, wovon Ärzte sprechen. Und Ärzte wüssten nicht, „wie Patienten ticken“. Dabei sei der Patient „der kompetente und ebenbürtige Experte in eigener Sache“, er kenne seine Befindlichkeiten, Bedürfnisse und Wertvorstellungen. Patienten sollten deshalb ihrem Arzt „ein Loch in den Bauch fragen“. Von Ärzten fordert er, Patienten zum Fragen zu ermutigen. Kritik übte Rambach daran, dass Apparatemedizin oft besser bezahlt wird als das Arzt-Patienten-Gespräch.
Kümmern wir uns mehr um Prozesse als um Wünsche und Wirklichkeit der Patienten?, fragte lakonisch Dr. Johannes Bruns, Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Als eine Ursache für die fehlende vernünftige Beweislage zu Patientenwünschen bezeichnet auch er die schnelle Verfügbarkeit von Medikamenten. Die Ziele der Patienten sollten deshalb nicht erst berücksichtigt werden, wenn das Medikament zugelassen ist. Shared-decision-Making sei schon in der Planung von Studien nötig.
Dr. Peter Kaskel, Market Access Oncology Team Lead Lung/Gastrointestinal Cancers, MSD Sharp & Dohme GmbH, sprach sich für die weitere Nutzung standardisierter und validierter Fragebogen zu Erfassung von patientenbezogenen Endpunkten aus. Dieser Standard stelle einen Grundkonsens dar und schaffe Planbarkeit in der Nutzenbewertung.
Quelle: Fachsymposium Onkologie