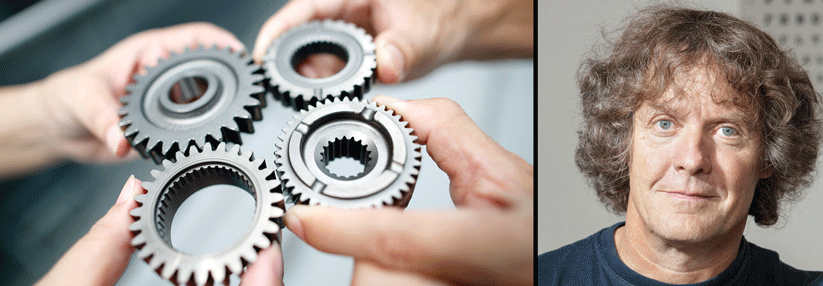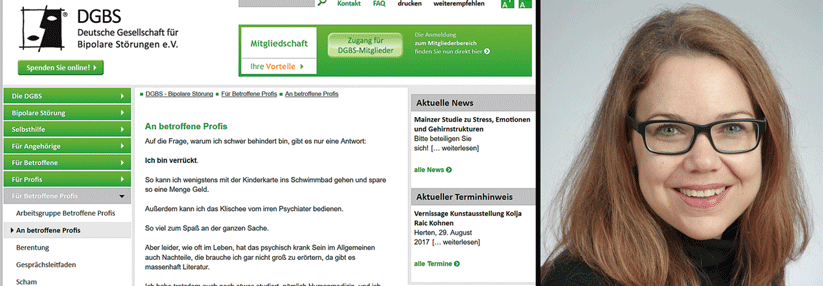
Ängste, Burn-out, Depression – Therapien für Mediziner mit psychischen Erkrankungen
 Die Prävalenz für eine depressive Störung ist bei Ärztinnen und Ärzten deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung.
© iStock/humonia
Die Prävalenz für eine depressive Störung ist bei Ärztinnen und Ärzten deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung.
© iStock/humonia
Frau Dr. Braun, mit Ihrem Therapieangebot wenden Sie sich speziell an Ärztinnen und Ärzte. Brauchen Mediziner andere Therapien als andere Patienten?
Dr. Maxi Braun: Naja, sie benötigen auf jeden Fall genauso Therapie wie andere Patienten auch. Und zwar sowohl somatische wie auch psychotherapeutische Therapien. Dabei ist es für sie aber oft schon eine sehr große Hürde, sich eine eigene Erkrankung einzugestehen. Eine unserer Patientinnen ignorierte monatelang ein Nebelsehen – bis letztlich ein behandlungsbedürftiges Glaukom diagnostiziert wurde.
Oft werden bei Beschwerden auch befreundete Kollegen informell zu Rate gezogen – aber ohne Behandlungsauftrag. So beriet sich ein Patient mit Kollegen wegen einer chronischen LWS-Schmerzsymptomatik, ohne dass jemals eine abschließende Bildgebung stattgefunden hat.
Was macht die Sache so schwierig und wie geht man damit um?
Dr. Braun: Für „Helfer-Patienten“ ist der Rollenwechsel, wenn sie selbst zum Patient werden, oftmals schambehaftet. Die Situation stellt das eigene Selbstbild infrage. Und auf der anderen Seite sorgen sich manchmal die behandelnden Kollegen, ob sie dem ärztlichen Patienten überhaupt gerecht werden können, also ob beispielsweise ein Assistenzarzt einen Oberarzt behandeln kann.
Ich finde es wichtig, den ärztlichen Patienten auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen ein hohes Maß an Kontrolle über die eigene Therapie zu überlassen. Und gleichzeitig muss man klare Grenzen ziehen und sehen, dass es sich um eine Arzt-Patienten-Beziehung handelt und nicht etwa um ein kollegiales Gespräch.
Was zeichnet Ihre Therapien für Ärztinnen und Ärzte aus?
Dr. Braun: Die Therapien haben eine ähnliche Struktur wie die für unsere anderen Patienten, aber teilweise mit einem anderen inhaltlichen Schwerpunkt. Grundsätzlich verfolgen wir moderne therapeutische Ansätze unterschiedlicher Behandlungskonzepte. In der Einzel- und teilweise auch in der Gruppentherapie wird dabei ein Modell für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung vor dem jeweils eigenen biografischen Hintergrund entwickelt.
Ärzte und Therapeuten zeigen dabei häufig ganz spezifische wiederkehrende Schemata wie etwa „unerbittliche Standards“ oder „Aufopferung“. An dem Punkt zeigt sich also eine mentale Struktur mit automatischen Kognitionen, Erinnerungen, Emotionen und Verhaltensmustern, deren Ursprung biografisch verankert ist. Deswegen ist unserer Erfahrung nach für das Ärzte-Setting der Fokus auf biografische Erfahrungen und die Frage „Warum bin ich wirklich Arzt geworden?“ vielversprechend. Genauso wie auch die Betonung der emotionalen Prozesse und der therapeutischen Beziehung, über die wir auch ärztliche Patienten, die selbst einen theoretischen Hintergrund in der Psychotherapie haben, behandeln können.
Ein weiterer unserer Therapieschwerpunkte ist die Wahrnehmung und Regulation von Emotionen. Dabei geht es natürlich auch um mögliche Schwierigkeiten in der Arzt-Patienten-Beziehung, etwa durch mangelnde Grenzziehung. Zusätzlich versuchen wir, Alltagsachtsamkeit, Selbstwahrnehmung und Ressourcenaufbau zu fördern und für spezifische Belastungsfaktoren, die sich aus dem Beruf ergeben, wie etwa die Priorisierung von den teils unendlich erscheinenden Anforderungen im ärztlichen Alltag, Lösungsansätze zu suchen.
Was hat Sie denken lassen, dass ein spezielles Angebot für Ärztinnen und Ärzte notwendig ist?
Dr. Braun: Bei meiner früheren Forschungstätigkeit an der Universität Ulm war das Thema „Ärztegesundheit“ mein Forschungsschwerpunkt. Dabei fiel mir auf, dass es in Deutschland wenig Zahlen zur Prävalenz und noch weniger Therapieangebote für betroffene Kollegen gibt. Ziel unserer Arbeitsgruppe war es damals, entsprechende epidemiologische Daten zu erheben, um zu sehen, ob es einen Behandlungsbedarf überhaupt gibt.
Wir haben dann mehrfach deutlich erhöhte Zahlen hinsichtlich Burn-out, Depressivität und Substanzgebrauch im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung gefunden. Dabei gibt es aber gleichzeitig nur sehr wenige stationäre Angebote für psychisch erkrankte Kollegen. Die Klinik Kloster Dießen bietet mir durch die landschaftliche und räumliche Situation, in der sich wunderbar Ressourcen generieren lassen und die gleichzeitig viel Diskretion möglich macht, einen idealen Platz, eine Behandlungseinheit für psychisch erkrankte Helfer aufzubauen.
Sie sagen, Ärztinnen und Ärzte haben spezifische Probleme und leiden z.B. häufiger an psychischen Problemen. Wissen die Ärzte das?
Dr. Braun: Tatsächlich scheinen viele Kolleginnen und Kollegen die eigene „Verwundbarkeit“ noch immer schlechter wahrzunehmen. Auch das Bild, das die Angehörigen des Arztes von diesem haben, ist oft nur schwer korrigierbar. Dabei scheint bei Ärztinnen und Ärzten die Punktprävalenz für eine klinisch relevante depressive Störung mit 6 bis 13 % und die Lebenszeitprävalenz mit 41 bis 45 % deutlich höher zu liegen als in der Allgemeinbevölkerung! Komorbid finden sich bei ihnen häufig Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, ADHS und Substanzmissbrauch. Besonders betroffen sind davon übrigens Notfallmediziner, Internisten, Allgemeinmediziner, Neurologen und auch Psychiater und Psychotherapeuten.
Dabei haben aktuellen Studien zufolge die Zufriedenheit im Arbeitskontext und die eigene Gesundheit einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Güte der Patientenversorgung. Und es liegen Studien vor, die eine enge Korrelation zwischen verschiedenen Dimensionen von Burn-out und medizinischen Fehlern zeigen.
Für Ärzte ist das Thema wie gesagt extrem schambelastet, auch, weil sie oft einen sehr hohen Anspruch an sich haben und ein eigenes Versagen kaum aushalten. Und die Ärztekammern der einzelnen Bundesländer haben zwar Hilfsangebote für substanzabhängige Kollegen, aber meines Wissens kaum Angebote für anderweitig psychisch erkrankte Mediziner.
Wann raten Sie Ärztinnen und Ärzten besonders, sich an eine Einrichtung wie die Ihre zu wenden?
Dr. Braun: In der aktuellen Coronasituation befinden sich sicherlich viele Kollegen im „Funktionsmodus“, um Höchstleistung zu erbringen. Das bedeutet auch, dass berufliche und private Ressourcenpflege nur sehr reduziert möglich ist. Langfristig kann aus einer solchen Situation ein Burn-out, eine „Erschöpfungsdepression“ entstehen.
Wir behandeln schwerpunktmäßig sämtliche depressiven Erkrankungen, Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Reaktionen auf schwere Belastungen, somatoforme Störungen sowie Internet- bzw. Computerspielabhängigkeit. Die Kosten für die stationäre Behandlung einer psychisch oder psychosomatisch bedingten Erkrankung tragen die jeweiligen gesetzlichen oder privaten Krankenkassen der Patienten.
Für die Behandlung von substanzabhängigen Patienten benötigt es dagegen teils eine andere therapeutische Herangehensweise und vor allem ein anderes klinisches Back-up. Daher behandeln wir diese Patienten nicht.
Sie bieten seit Ende November 2019 eine Behandlungseinheit mit acht Therapieplätzen an. Wie groß ist die Nachfrage?
Dr. Braun: Von den angestellten Kolleginnen und Kollegen wird unser Angebot gut angenommen. Allerdings sehen wir niedergelassene Kollegen bisher eher selten. Es ist wohl eine höhere Hürde, sich vertreten zu lassen oder die eigene Praxis zu schließen, zumal das einen Verdienstausfall nach sich zieht. Die Patientinnen und Patienten sind etwa sechs bis acht Wochen bei uns, mindestens vier, maximal zwölf Wochen.
Wir haben aber auch schon Kollegen gesehen, die ihre Praxis aufgrund einer eigenen psychischen Erkrankung bereits verkauft hatten, weil sie den herausfordernden Praxisalltag nicht mehr bewältigen konnten, oder die sich in einer beruflichen Umbruchssituation befanden. Ärztliche Patienten begeben sich einfach leider erst sehr spät in die Klinik, also erst bei lange bestehender oder schwerer psychischer Erkrankung. Ich denke, die Situation wäre anders, wenn bereits während des Medizinstudiums und auch während der späteren eigenen ärztlichen Tätigkeit Präventions- und niederschwellige ambulante Angebote vorgesehen wären.
Medical-Tribune-Interview