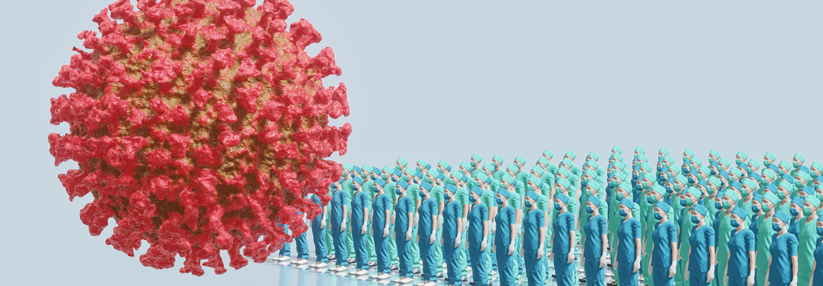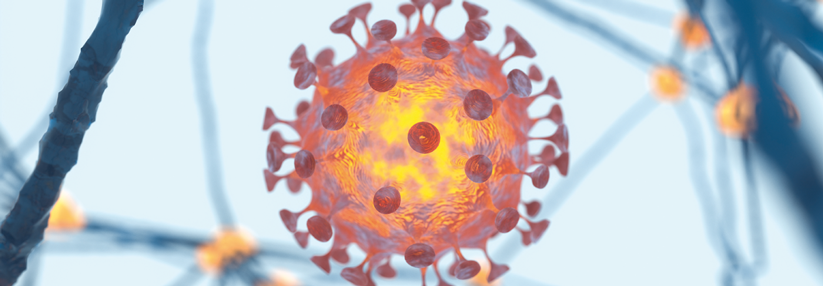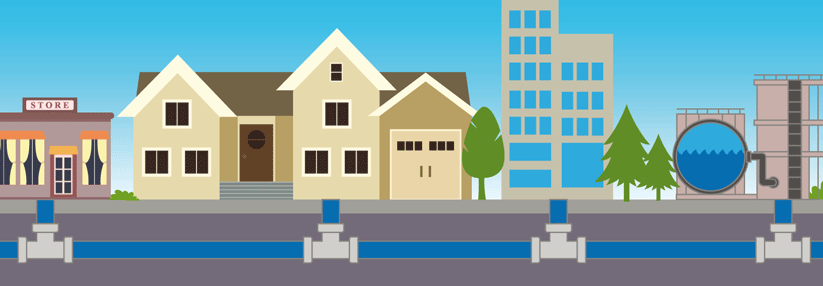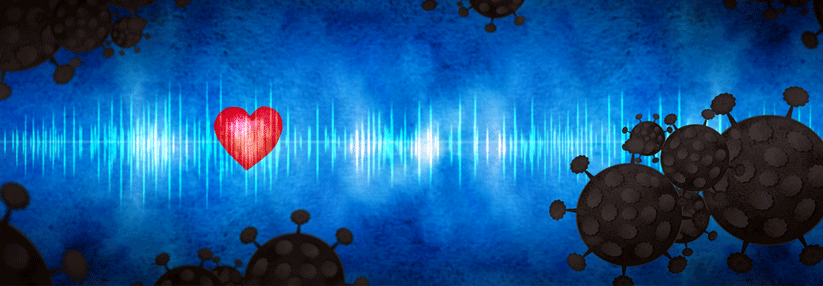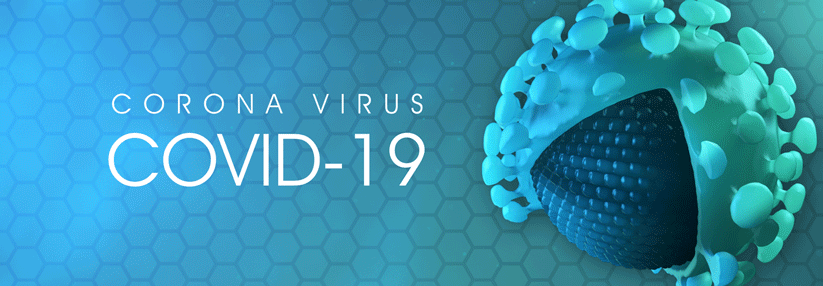
Corona trifft psychisch Kranke auch ohne Infektion
 Die Pandemie unterbricht oft die mühsam aufgebauten Routinen von Menschen mit psychischen Erkrankungen. (Agenturfoto)
© iStock/dragana991
Die Pandemie unterbricht oft die mühsam aufgebauten Routinen von Menschen mit psychischen Erkrankungen. (Agenturfoto)
© iStock/dragana991
Vermutlich gibt es kaum jemanden, der seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie nicht in irgendeinem Lebensbereich zurückstecken musste. Auch rund ein halbes Jahr später hält das Coronavirus die Gesellschaft noch in Atem. Doch was ist mit jenen, die ohnehin im Alltag zu kämpfen haben?
Anstieg suizidaler Handlungen befürchtet
Personen mit manifesten Depressionen oder Angststörungen leiden noch mehr als Gesunde unter dem Verlust sozialer Kontakte. Sie leben krankheitsbedingt bereits stärker zurückgezogen und sind häufig auf mühsam aufgebaute Routinen angewiesen. Die oftmals wenig erbauliche Krisenkommunikation der Medien liefert negativen Gedankenspiralen zusätzlich einen idealen Nährboden. Das kann das ohnehin ausgelastete psychiatrische Versorgungssystem kaum auffangen. Erschwert durch die allgegenwärtigen Kontaktbeschränkungen nehmen Betroffene die Hilfen außerdem noch seltener als zuvor in Anspruch.
Bisher fehlen dafür zwar größtenteils empirische Belege, Dr. Tarik Karakaya vom Universitätsklinikum Frankfurt und Kollegen befürchten allerdings, dass suizidale Handlungen infolge der Krise zunehmen werden. Zumindest in den stark durch Corona gebeutelten USA ist die Selbstmordrate bereits deutlich gestiegen. Auch wenn der direkte Vergleich zur Situation in Deutschland in vielen Punkten hinkt, wäre es sinnvoll, präventive Schritte einzuleiten, indem beispielsweise Hilfsangebote erleichtert und Risikogruppen direkt angesprochen werden.
Gleichzeitig, aber nicht gleich
Kaum Selbsthilfegruppen für Suchtpatienten
Suchtkranken, die es aus der Abhängigkeit geschafft haben, macht die Pandemie das abstinente Leben nicht leichter. Selbsthilfegruppen und Gruppentherapien – von denen die Anonymen Alkoholiker sicher am bekanntesten sind – finden derzeit kaum noch statt, mahnen die Autoren. Gleiches gilt für elektive stationäre Behandlungen. Und nicht für jeden bietet die Telemedizin Ersatz. Zusätzlich gibt es generell bei Suchtpatienten eine hohe Rate an Komorbiditäten bzw. Folgeerkrankungen, die beachtet und behandelt werden müssen. Nicht grundlos warnen Verbände und Fachgesellschaften ausdrücklich davor, dass der Zusammenbruch der Suchthilfe die akutmedizinischen Stellen belasten wird. Noch düsterer scheinen die Aussichten angesichts eines Trends, der sich seit März abzeichnet: Um Stress und Konflikte im Rahmen der Pandemie zu bewältigen, wird vermehrt zur Flasche gegriffen – von der gesamten Gesellschaft. Dass Betrunkene sich weniger an Abstandsregeln halten und der Konsum von Alkohol die Schwelle zur (häuslichen) Gewalt herabsenkt, muss kaum erwähnt werden. Das bestätigen auch die aus Frauenhäusern gemeldeten Daten.Angst im Altenheim
Quelle: Karakaya T et al. Hessisches Ärzteblatt 2020; 7/8: 394-399