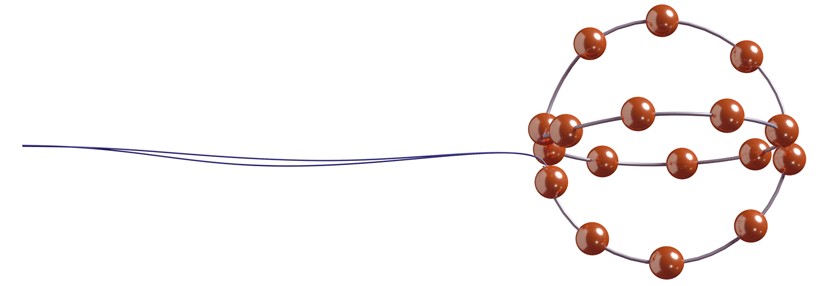Abtreibung erzwungen, Verhütung verwehrt Wie man reproduktive Nötigung erkennt
 Wenn Frauen über ihre Fortpflanzung nicht frei entscheiden können, sondern von Partner oder Eltern unter Druck gesetzt werden, ist medizinische Unterstützung gefragt.
© SB Arts Media - stock.adobe.com
Wenn Frauen über ihre Fortpflanzung nicht frei entscheiden können, sondern von Partner oder Eltern unter Druck gesetzt werden, ist medizinische Unterstützung gefragt.
© SB Arts Media - stock.adobe.com
Reproduktive Nötigung betrifft meist Frauen. Sie schränkt die Autonomie der Betroffenen ein und gilt als geschlechtsspezifische Gewalt. Es wird dabei entweder eine Schwangerschaft initiiert oder gegen den Willen der Frau verhindert bzw. beendet. Beispiele für mögliche Aktionen sind erzwungene Verhütung einschließlich Sterilisation oder, im Gegenteil, sabotierte Verhütung durch Verzicht auf Kondome oder Verbot einer Kontrazeption.
Lassen sich in einer Hausarztpraxis solche Situationen erkennen und wie reagiert man darauf? Das wollten Susan Saldanha, Monash University School of Public Health and Preventive Medicine, Melbourne, und ihre Kolleginnen wissen. Sie befragten mithilfe halbstrukturierten Interviews über Zoom zehn Hausärztinnen und sechs Fachangestellte. Viele von ihnen gaben an, dass reproduktive Nötigung oft im Kontext von physischer oder sexueller Gewalt auftritt. Einige der Studienteilnehmerinnen hatten die Erfahrung gemacht, dass ausschließlich psychologischer oder emotionaler Druck aufgebaut wird und körperliche Übergriffe unterbleiben. So hatte beispielsweise der Partner einer Frau gedroht, sie zu verlassen, wenn sie die Schwangerschaft nicht beendet.
Kontrollverhalten ist ein typisches Warnzeichen
Als Warnzeichen für reproduktive Nötigung nannten die Ärztinnen und Helferinnen folgende Kriterien:
- Der Partner dominiert das Beratungsgespräch, die Patientin kommt kaum zu Wort.
- Der Partner ist immer dabei.
- Der Partner kontrolliert die Kommunikation, verhindert z. B., dass die Patientin allein mit der Ärztin spricht.
- Die Patientin fühlt sich bei der Konsultation sichtbar unwohl.
- Die Patientin wirkt wenig selbstbewusst (senkt den Kopf, vermeidet Augenkontakt, entschuldigt sich häufig).
- Die Kontrazeption wird vor dem Partner geheim gehalten.
- Es ist bereits zu mehreren Aborten gekommen oder Termine zum Schwangerschaftsabbruch wurden in letzter Sekunde abgesagt.
- Es existieren Zeichen von Depression, Angst, Scham, Schuldgefühlen, Gewissensbissen beziehungsweise für ein psychisches Trauma.
- Die Patientin äußert somatische Beschwerden, z. B. Bauchschmerzen, ohne entsprechenden Befund.
- Arztkonsultationen werden vermieden bzw. hinausgezögert.
Die Studienteilnehmerinnen waren sich einig, dass bei entsprechendem Verdacht aktiv nachgefragt werden muss. Als Vorschläge zur Formulierung nannten sie zum Beispiel: „Haben Sie irgendwelche Bedenken, was Ihre Sicherheit zu Hause oder mit Ihrem Partner angeht?“ oder „Manchmal haben Partner unterschiedliche Meinungen, lassen Sie uns darüber reden“. Allerdings sollte man bei der Exploration behutsam und angepasst an die individuelle Situation vorgehen, lautete eine häufig geäußerte Ansicht. Das Insistieren auf einem Vier-Augen-Gespräch mit der Patientin richtet manchmal mehr Schaden an, als dass es nutzt, sofern die Sicherheit der Patientin zu Hause in Gefahr ist. Auch bei Jugendlichen oder Patientinnen mit Behinderungen, die auf die Hilfe von Eltern oder Betreuenden angewiesen sind, ist diesbezügliche Vorsicht geboten.
Manchmal hilft es, mit dem Partner zu reden
Wie man auf einen Fall von reproduktiver Nötigung reagieren sollte, hängt auch von den individuellen Umständen ab. So sei es zwar ein integraler Bestandteil der Beratung, Frauen über ihre reproduktiven Rechte aufzuklären, meinen die Expertinnen. Manchmal müsse man aber auch mit dem Partner reden, damit er versteht, dass er nicht über den Körper seiner Frau entscheiden darf.
Die Befragten ließen zudem ein hohes Ausmaß an Kreativität erkennen. Beispielsweise halfen sie Patientinnen, einen Abbruch zu praktizieren, ohne dass der Partner davon erfährt. Die Autorinnen hoffen, dass die Erkenntnisse ihrer Studie dazu beitragen, entsprechende bislang nicht vorhandene Leitlinien zum Umgang mit reproduktiver Nötigung zu entwickeln.
Quelle: Saldana S et al. BMJ Sex Reprod Health 2025;
doi: 1136/bmjsrh-2025-202944