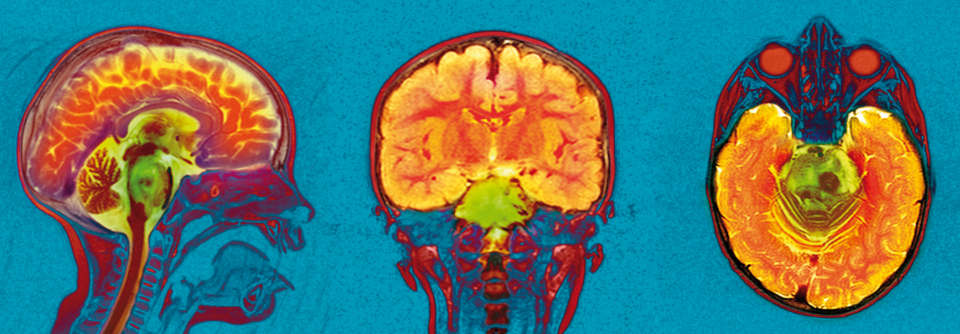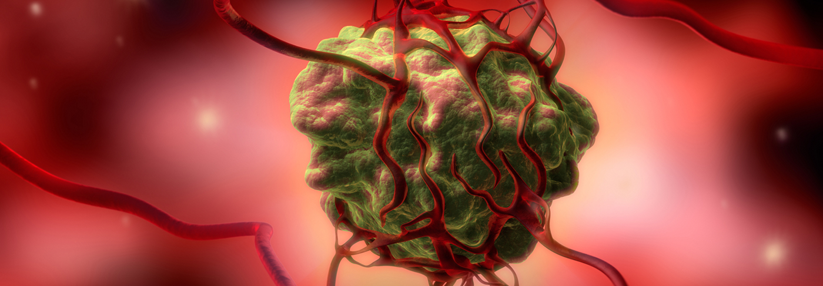Interview Shared Decision Making: „Erkrankte sind zufriedener und adhärenter“
 Dr. Deborah Christen erklärt, wie Shared Decision Making gelingt und warum es im Klinikalltag oft scheitert.
© rogerphoto – stock.adobe.com
Dr. Deborah Christen erklärt, wie Shared Decision Making gelingt und warum es im Klinikalltag oft scheitert.
© rogerphoto – stock.adobe.com
Dr. Christen, welche Vorteile bietet „Shared Decision Making“?
Shared Decision Making, kurz SDM, bedeutet, dass Patient:innen und Ärzt:innen medizinische Entscheidungen gemeinsam treffen, gleichberechtigt auf Augenhöhe. Es bietet den Vorteil, dass Behandelte zufriedener mit den gewählten Entscheidungen sind und sie weniger oft bereuen. Entsprechend bleiben sie dann therapieadhärenter. Mir persönlich als Ärztin gibt es ebenfalls ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, dass wir beide hinter der Entscheidung stehen.
Obwohl es gewünscht und seit 2013 sogar im Patientenrechtegesetz festgeschrieben ist, dass Patient:innen und Ärzt:innen bei der Behandlung zusammenwirken sollen, findet SDM noch nicht routinemäßig Anwendung. Oft geben immer noch Mediziner:innen die Entscheidungen vor und Erkrankte erleben eine passive Rolle.
Was steht einer gemeinsamen Entscheidungsfindung im Klinikalltag im Wege?
Vor allem hat beim Shared Decision Making die Kommunikation einen zentralen Stellenwert, die bislang in der fachärztlichen Ausbildung zu kurz kommt – hier besteht meiner Meinung nach noch ein riesiger Bedarf an Kommunikationstrainings. Ärzt:innen können lernen, welche einfachen Maßnahmen bereits dazu beitragen, eine Entscheidung gemeinsam zu gestalten.
Außerdem müssen Patient:innen gut über ihre Erkrankung und die verfügbaren Therapieoptionen informiert sein. Da bleibt die Frage, wie man optimal aufklärt und die Behandlungsmöglichkeiten gleichberechtigt darstellt.
Wie lässt sich die Einbeziehung von Patient:innen konkret verbessern?
Zuerst sollten Mediziner:innen das Ziel des Gesprächs und die zu treffende Entscheidung klar benennen und Betroffene direkt dazu einladen, sich zu beteiligen. Dann sollten sämtliche Optionen, die zur Verfügung stehen, transparent aufgezeigt und erklärt werden, inklusive der möglichen Vor- und Nachteile aller dieser Varianten.
Der wichtigste Punkt bleibt aber, dass Erkrankte ihre eigenen Präferenzen in die Entscheidung mit einfließen lassen sollen. Man versucht, im Gespräch gemeinsam herauszuarbeiten: Was sind ihre ganz persönlichen Therapieziele? Was sind möglicherweise Lebensumstände, die ihre Entscheidung beeinflussen können? Was sind persönliche Ängste, was sind persönliche Sorgen bei einer Therapie?
Was sagen Sie Erkrankten, die davor zurückscheuen, Verantwortung zu übernehmen?
Im Alltag erleben wir durchaus die abwehrende Reaktion, man könne eine solche Entscheidung nicht treffen, da man kein Fachmann, keine Fachfrau sei. Umso wichtiger ist dann, zu signalisieren, dass man die Patient:innen mit der Entscheidung nicht allein lässt: „Wir wollen das gemeinsam entscheiden.“ Sonst können sich Erkrankte tatsächlich überfordert fühlen.
Auch im Rahmen der Erstdiagnose einer Tumorerkrankung fällt es durch die Schocksituation vielen Patient:innen zunächst schwer, alle Informationen aufzunehmen und sich hinterher an das Gespräch zu erinnern. Daher halte ich es für hilfreich, dass Angehörige zu diesen Terminen begleiten.
Wo wird Shared Decision Making bereits systematisch umgesetzt?
In dem Projekt „Making SDM a Reality“ wurde SDM am gesamten Universitätsklinikum Kiel mithilfe des hierfür entwickelten „SHARE TO CARE“-Programmes erfolgreich im Klinikalltag integriert. Dieses Programm setzt sich aus mehreren SDM-Maßnahmen zusammen. Zunächst einmal erhielten Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegekräfte, ein Kommunikationstraining. Es wurden Entscheidungshilfen entworfen und systematisch eingesetzt. Gleichzeitig aktivierte man Patient:innen über Plakate und Flyer und motivierte sie so zur Teilnahme.
Wir in Aachen haben einen vergleichbaren, jedoch entitätenbezogenen Ansatz als Pilotprojekt für drei seltene hämatologische Erkrankungen implementiert: Myelofibrose, paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie und aplastische Anämie. Dies geschah im Rahmen der PELIKAN-Studie („Partizipative Entscheidungsfindung für seltene hämatologische und onkologische Erkrankungen“). Das Ziel ist natürlich, solche Maßnahmen über einzelne Einrichtungen hinaus auszuweiten, damit möglichst alle Patient:innen mit den betreffenden Erkrankungen vom Shared Decision Making profitieren können.
Was kann man sich unter Entscheidungshilfen vorstellen?
Entscheidungshilfen sind Medien, die Betroffenen einerseits Informationen über ihre Erkrankung liefern und andererseits alle verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen und in patientenfreundlicher Sprache erklären. Dabei kann es sich um Texte, Videos oder Grafiken handeln. Sie legen Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen dar, ihre Risiken und Erfolgschancen. Jede davon wurde gezielt für eine ganz bestimmte Entscheidung entwickelt.
Anders als bei klassischen Informationsmaterialien sollen Entscheidungshilfen Erkrankte dazu anregen, die Inhalte auf ihre eigene Situation zu übertragen, und sie in der Herausarbeitung ihrer eigenen Präferenzen unterstützen. Manchmal gibt es auch ein Feedbackwerkzeug, das hilft, einzuschätzen, welche Wahl individuell am besten passt. Sie gehen also über die reine Informationsvermittlung hinaus.
Wie läuft die praktische Umsetzung bei Ihnen in Aachen?
Zunächst einmal haben alle Ärzt:innen an einem Kommunikationstraining teilgenommen. Für die drei genannten hämatologischen Erkrankungen sind Entscheidungshilfen entstanden, die wir an die Patient:innen aushändigen, die mit dem jeweiligen Anliegen zu uns kommen. Die Nutzung bleibt natürlich freiwillig, aber meiner Erfahrung nach werden sie gut angenommen, nicht nur von Erkrankten, auch von Angehörigen.
Die Entscheidungshilfe soll natürlich das Arztgespräch nicht ersetzen. Sie kann aber helfen, sich beim Folgetermin auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren und offene Fragen zu klären. So können Patient:innen wirklich ihre Präferenzen einbringen. Zusätzlich bieten wir ein Gespräch mit einem Decision Coach an. Dabei handelt es sich um nicht-ärztliches medizinisches Fachpersonal, das speziell ausgebildet wurde, um Erkrankte bei solchen Entscheidungen zu unterstützen.
Welche Alltagstipps können Sie Kolleg:innen mitgeben?
Zum einen sind die Entscheidungshilfen, die wir in Aachen entwickelt haben, online frei zugänglich. Ärzt:innen, die Betroffene mit denselben Fragestellungen betreuen, können diese schon jetzt verwenden.
Kolleg:innen können sich zum anderen vornehmen, Erkrankte im Gespräch aktiv zur Mitwirkung einzuladen, gezielt Präferenzen zu erfragen und herauszuarbeiten. Das sind meiner Meinung nach Dinge, die sich gut im Klinikalltag unterbringen lassen.
Interview: Lara Sommer