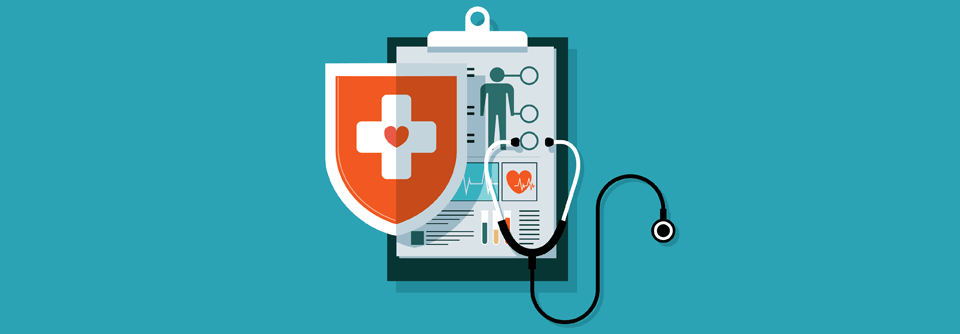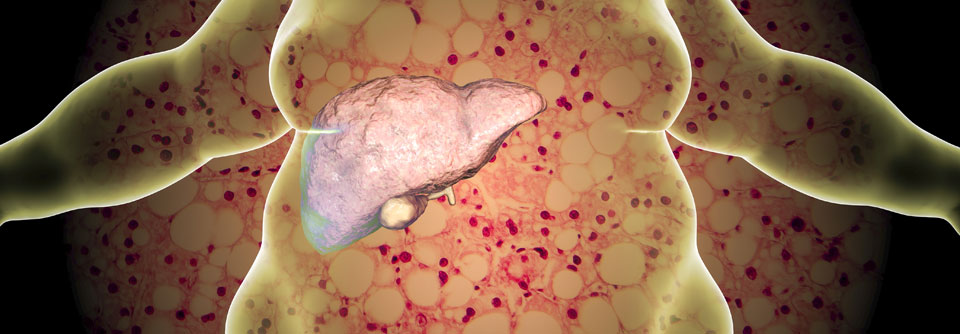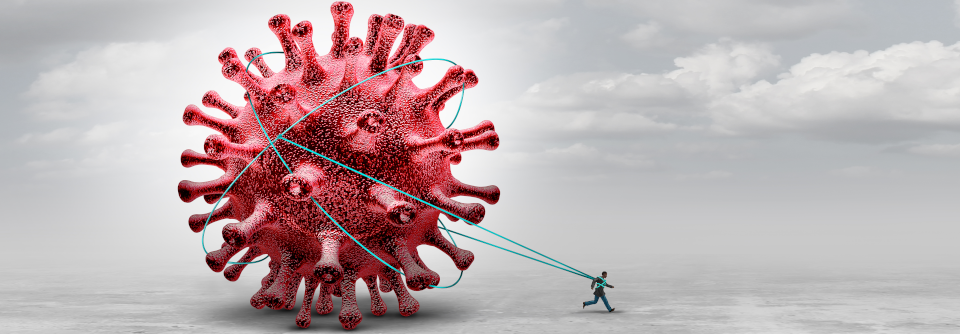Prämenstruelle dysphorische Störung Diagnosekriterien beeinflussen Prävalenz
 Eine Limitierung auf Stichproben der Allgemeinbevölkerung mit bestätigter Diagnose reduzierte die Heterogenität deutlich. (Agenturfoto)
© Goffkein – stock.adobe.com
Eine Limitierung auf Stichproben der Allgemeinbevölkerung mit bestätigter Diagnose reduzierte die Heterogenität deutlich. (Agenturfoto)
© Goffkein – stock.adobe.com
Die Symptome einer prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS) äußern sich in der Woche vor der Menstruation. Um eine Diagnose bestätigen zu können, müssen mindestens zwei Zyklen analysiert werden. Geschieht dies nicht, wird gemäß DSM-Kriterien von einer „provisorischen“ PMDS-Diagnose gesprochen. Beide Diagnoseformen werden bisher in der Literatur zur Ermittlung von Prävalenzen der PMDS herangezogen.
Studien, die sich auf provisorische Diagnosen verlassen, produzieren vermutlich künstlich erhöhte Prävalenzen, berichten Dr. Thomas Reilly, Abteilung für Psychiatrie der Universität Oxford, und Kollegen. In einer Metaanalyse hatten die Wissenschaftler Daten aus 44 Studien mit 48 unabhängigen Stichproben und mehr als 50.000 Teilnehmerinnen miteinander verglichen. Die gepoolten Daten der Stichproben ergaben unter menstruierenden Frauen eine Punktprävalenz von 7,7 % auf Basis von provisorischen und 3,2 % auf Basis von bestätigten Diagnosen.
Durch die Analyse zeigte sich nicht nur eine Heterogenität in Bezug auf die Diagnoseart, sondern auch hinsichtlich des Studiensettings: Untersuchungen im beruflichen, bildungs- oder sportbezogenen Umfeld lieferten deutlich höhere Prävalenzen.
Eine Limitierung auf Stichproben der Allgemeinbevölkerung mit bestätigter Diagnose reduzierte die Heterogenität deutlich. Aus den verbliebenen sechs Stichproben ergab sich eine Punktprävalenz der PMDS von 1,6 %. Der Prozentwert sei niedriger als die bisher berichteten, schließen die Forscher. Sie geben jedoch zu bedenken, dass es sich um eine Punkt- und keine Lebenszeitprävalenz handle.
Quelle: Reilly TJ et al. Journ Aff Dis 2024; DOI: 10.1016/j.jad.2024.01.066