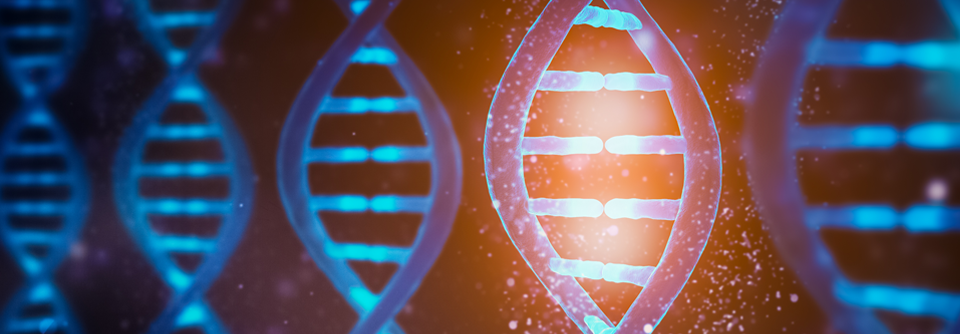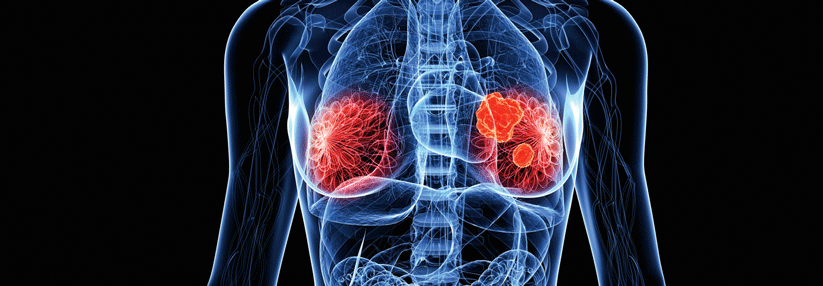
Interview Prof. Dr. Rita Schmutzler über die Beratungsarbeit zum familiären Brustkrebs
 Prof. Dr. Rita Schmutzler spricht in einem Interview über neue Optionen der individuellen Risikokalkulation und die Herausforderungen der genetischen Beratung.
© sdecoret – stock.adobe.com
Prof. Dr. Rita Schmutzler spricht in einem Interview über neue Optionen der individuellen Risikokalkulation und die Herausforderungen der genetischen Beratung.
© sdecoret – stock.adobe.com
Hat sich in den letzten Jahren etwas am Risikobewusstsein Ihrer Patient:innen gewandelt? Sieht man einen Trend, dass genetische Beratung häufiger in Anspruch genommen wird?
Prof. Dr. Rita Schmutzler: Die Anzahl der Ratsuchenden, die über ihr Risiko informiert werden wollen, ist deutlich in die Höhe gegangen. Man gewinnt den Eindruck, dass sich die Menschen mehr als früher mit Gesundheitsrisiken beschäftigen, was hoffentlich auch das Bewusstsein für präventive Maßnahmen schärft.
Welche neuen Indikatoren sind in den letzten Jahren zu den klassischen Risikogenen für Brust- und/oder Eierstockkrebs dazugekommen?
Prof. Schmutzler: Wir wissen immer mehr über die genetischen Hintergründe. Bei 30 % der Brustkrebserkrankungen liegt eine familiäre Belastung vor, welche auf genetische Ursachen hinweist. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl neuer Risikogene identifiziert, sodass Spezialist:innen jetzt eine Genpanel-Analyse durchführen können. Gleichzeitig weiß man schon seit Langem, dass es auch nicht-genetische Risikofaktoren gibt, die für Brustkrebs relevant sind. Mittlerweile können wir all diese Faktoren auch gebündelt betrachten und dann ein individuelles Erkrankungsrisiko für die betreffende Person kalkulieren.
Wie wirkt sich das Ergebnis des polygenischen Risikoscores (PRS) auf die Wahrscheinlichkeit aus, an Brustkrebs zu erkranken?
Prof. Schmutzler: Der PRS berücksichtigt eine Reihe von genetischen Faktoren, von denen jeder einzelne eine Risikoveränderung von deutlich weniger als 1 % ausmacht. Gebündelt haben sie aber einen relevanten Einfluss auf das individuelle Risiko. Man kann grob sagen: Das Lebenszeitrisiko in der Allgemeinbevölkerung von 10 % kann mithilfe des PRS in ein Spektrum zwischen 5 % und 15–20 % aufgesplittet werden. Da kann man schon für die breite Masse diskutieren, ob Anpassungen bei der Früherkennung sinnvoll sind.
Im Falle einer BRCA1-Mutationsträgerin mit einem durchschnittlichen lebenslangen Brustkrebsrisiko von 70 % kann dieses abhängig vom PRS bei 50 % liegen, aber auch auf 85–90 % schnellen. Der PRS hat insbesondere auch einen Einfluss auf das Erkrankungsalter. Auf Basis der individuellen Erkrankungswahrscheinlichkeit können Betroffene damit fundierter entscheiden, ob und wann eine prophylaktische Operation für sie infrage kommt.
Werden diese neuen Erkenntnisse bereits in der Beratungspraxis angewendet?
Prof. Schmutzler: Für Risikopersonen, die spezialisierte Zentren aufsuchen, können wir das Konzept in diesem Jahr auf eine breitere Basis stellen. Bei uns in Köln führen wir die Untersuchung bereits routinemäßig durch, im Konsortium der 23 Zentren wird es gerade etabliert.
Ich glaube allerdings nicht, dass der PRS schon reif für die Regelversorgung ist. Es bleiben offene Fragen, zuallererst, wie man die Getesteten adäquat über das Ergebnis informiert. Eine weitere Frage ist, wie sich das Ganze auf die Effizienz der intensivierten Früherkennung auswirkt. Diese Daten wollen wir nun an den spezialisierten Zentren erheben und zügig auswerten.
Was ist Ihrer Meinung nach besonders wichtig, um die Ratsuchenden bestmöglich bei der Entscheidung zu unterstützen?
Prof. Schmutzler: Ganz im Vordergrund steht die nicht-direktive Beratung. Das heißt, unser Angebot soll bei einer maßgeschneiderten Entscheidungsfindung für jeden Einzelnen helfen. Man muss beispielsweise berücksichtigen, wie alt die Person ist und in welcher Lebensphase sie sich befindet, aber auch, wie diejenige sonst mit Risiken im Leben umgeht. Bei der Entscheidung zwischen prophylaktischer Operation und intensivierter Früherkennung gibt es kein richtig oder falsch. Auch bei hohem Risiko muss man im Kopf behalten, dass ein Teil der Frauen niemals erkranken wird. Für diejenigen ist alles, was wir tun, eigentlich zu viel.
Beeinflussen psychologische Faktoren die Entscheidung?
Prof. Schmutzler: Natürlich sind Persönlichkeit und Psychologie absolut wichtig. Als in unseren Studien psychologische Parameter erhoben wurden, wiesen Risikopersonen erwartungsgemäß erhöhte Angstwerte auf. Wir fanden es hingegen erfreulich und beeindruckend, dass sich keine erhöhten Depressionswerte zeigten.
Darüber hinaus bestand eine gewisse Korrelation zwischen besonders hohen Angstwerten und dem Wunsch nach einer Operation. Wenn die Ergebnisse der psychologischen Anamnese auf eine therapierelevante Angst oder Depression hindeuteten, haben wir den Frauen eine psychotherapeutische Unterstützung sehr ans Herz gelegt.
Interview: Lara Sommer, Dr. Judith Besseling