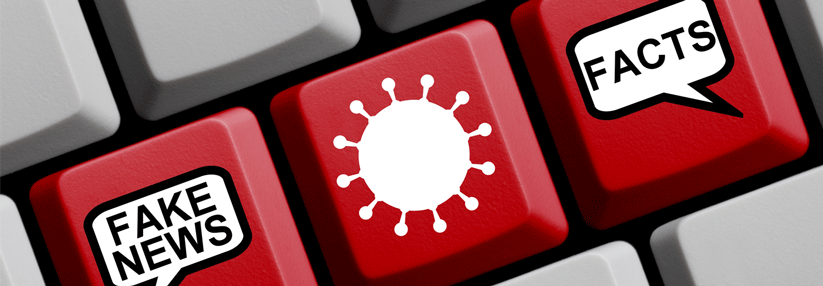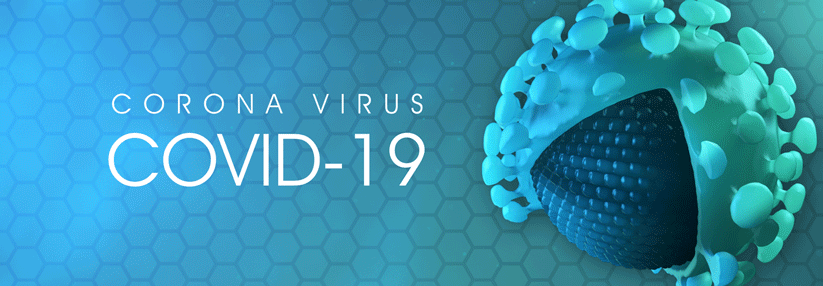
Berichterstattung in der Coronapandemie – Drama, Starkult und wenig Distanz
 Am Beispiel der Berichterstattung zur Coronapandemie zeigt sich die „Übersetzungsproblematik“ von Wissenschaft zu Journalismus.
© iStock/Feodora Chiosea
Am Beispiel der Berichterstattung zur Coronapandemie zeigt sich die „Übersetzungsproblematik“ von Wissenschaft zu Journalismus.
© iStock/Feodora Chiosea
In einer Zeit, in der weitreichende politische Entscheidungen ohne parlamentarische Abstimmung getroffen und Freiheitsrechte eingeschränkt werden, haben Menschen mehr denn je den Anspruch, von Medien distanziert und differenziert informiert zu werden – zumal diese sich selbst gerne auf eine politische Kontrollfunktion berufen. Doch ob dem Journalismus dies in den vergangenen Monaten gelang, ist umstritten. Kritik kommt nicht nur von Personen und Gruppierungen, die sich in ihrer eigenen Perspektive nicht repräsentiert fühlen, sondern auch von Medienwissenschaftlern.
Coronapandemie verändert Nutzungsverhalten
Die Pandemie scheint sich auf die Mediennutzung der Menschen ausgewirkt zu haben. So nahm die tägliche Nutzung zu Informationszwecken über alle Gattungen hinweg zu, insbesondere das Internet wurde öfter genutzt. Dies geht aus der repräsentativen „Mediengewichtungsstudie 2020-I“ der Medienanstalten hervor. Von März bis Juni haben sich demnach rund 95 % der Personen über 14 Jahre täglich durch Medien informiert, 2018 waren es noch 84 %. Die höchste subjektive Bedeutung für aktuelle Informationen zur Coronakrise hatte von April bis Juni das Fernsehen. Für 45 % der Befragten war es die wichtigste Quelle.
Medien berichten über Berichterstattung
Inhaltlich hat sich die Berichterstattung im Verlauf der Pandemie sichtlich gewandelt. Wenn nun öffentlich über Fehler diskutiert wird, drängt sich eine Feststellung auf: Auch die Kritik ist nur wahrnehmbar, weil sie von Medien als Thema aufgegriffen wird. Und natürlich unterliegen auch Beiträge, in denen bestimmte Mechanismen des Berichtens diskutiert oder kritisiert werden, ebenjenen Mechanismen – auch dieser Bericht selbst ist dafür symptomatisch. Die Pandemie scheint daher ebenso dazu beizutragen, dass Medien ihre eigene Rolle reflektieren und abwägen, welche Instrumente der Berichterstattung für welche Situationen angemessen sind. Vor einigen Monaten sah dies noch anders aus: Vor allem die Berichterstattung zu Beginn der Pandemie in Deutschland sehen einige Medienwissenschaftler kritisch. So erklärt der Journalist und Kommunikationswissenschaftler Professor Dr. Klaus Meier, dass Medien die Entscheidungen der Regierung und die Ratschläge einiger dominierender Virologen bis Mitte März tendenziell distanzlos und unkritisch verlautbart hätten, ohne eine eigene Recherche zu liefern. Er geht davon aus, dass viele Medienschaffende dies taten, weil sie sich einer „Verantwortungsethik“ verpflichtet gefühlt hätten: Um mögliche Folgen einer zu kritischen Berichterstattung zu vermeiden – etwa eine Verharmlosung des Virus oder eine weitere Verunsicherung der Menschen –, hätten sie sich eingeschränkt. Dies war seiner Meinung nach bis zum Lockdown vertretbar, spätestens ab Mitte März aber hätten Medien mehr Distanz, Vielfalt und Eigenrecherche zeigen müssen. Der Medienwissenschaftler Stephan Russ-Mohl formulierte sogar die These, die Medien hätten die Politik mit einer zu stark an der Pandemie ausgerichteten, teilweise ängsteschürenden Berichterstattung indirekt unter Druck gesetzt, einen Lockdown zu beschließen. Er hält coronabezogene Themen für überrepräsentiert. Laut dem Unternehmen „Institut für empirische Medienforschung“ machten diese im März und April zwischen 60 % und 73 % der Sendezeitanteile von „Tagesschau“ und „heute“ aus. Beiträge zur Klimadebatte hätten in ihren Spitzenzeiten dagegen kaum mehr als 10 % der Gesamtberichterstattung erreicht, führt Ruß-Mohl aus. Unzufrieden mit der Berichterstattung zeigten sich immer wieder auch Virologen. Die Pandemie offenbarte zwar, wie wichtig die publikumsorientierte Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse sein kann. Allerdings zeigte sich zudem, dass Probleme entstehen können, wenn Journalisten Informationen aus anderen sozialen Teilsystemen nach den Logiken ihrer Aufmerksamkeitsmechanismen aufbereiten.Personenkult und Drama statt Einblick in die Forschung
So wird kritisiert, dass bestimmte Methoden journalistischen Schreibens – z.B. das Personalisieren und Dramatisieren von Sachverhalten und Geschehnissen – zu einer verzerrten Darstellung des Forschungsbetriebs und der Ergebnisse führten. Insbesondere der Virologe Professor Dr. Christian Drosten bekam dies infolge der plötzlichen Aufmerksamkeit, die auf ihn gerichtet war, zu spüren. „Ich bin wirklich wütend darüber, wie hier Personen für ein Bild missbraucht werden, das Medien zeichnen wollen, um zu kontrastieren. Das muss wirklich aufhören“, sagte er in einer Folge seines NDR-Podcasts – wobei ihn natürlich auch die Auswahl dieses Zitats auf eine gewisse Weise personalisiert. Noch dazu ausgehend von einer Äußerung, die er in einem ganz speziellen Kontext machte. In vielen Medien war zudem eine Überhöhung des Virologen zu beobachten. Beispielsweise titelte ‚Die Zeit‘:„Ist das unser neuer Kanzler?“ Mit dem Falsifikationsprinzip der empirischen Forschung hätten sich einige Medien ebenfalls schwer getan, stellen verschiedene Journalisten fest. Die Wissenschaft erlangt neue Erkenntnisse durch das Widerlegen bestehender Hypothesen. Folglich ist das Falsifizieren von Annahmen und die Kritik an Studien innerhalb der Forschung selbstverständlich und notwendig. Einige Medien deuteten widerlegte Thesen allerdings geradezu als ein persönliches Scheitern der Forscher. So übte die Bild-Zeitung beispielsweise heftige Kritik an Studienergebnissen, die ein Team rund um Prof. Drosten auf einen Preprint-Server hochgeladen hatte. Der Artikel zitierte – offenbar recht zusammenhangslos – andere Wissenschaftler, die das methodische Vorgehen der Studie kritisierten. Ein üblicher Forschungsprozess wurde so zu einem vermeintlichen Gelehrtenstreit skandalisiert. Allerdings kann es auch gelingen, wissenschaftliche Erkenntnisse journalistisch ansprechend und inhaltlich korrekt an ein breites Publikum zu vermitteln. So erreichten die Videos, in denen die Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin, Fernsehmoderatorin und Youtuberin Mai Thi Nguyen-Kim den Verlauf der Pandemie erklärte, über sechs Millionen Aufrufe. Sie trat daraufhin in verschiedenen Fernsehformaten auf, erhielt das Bundesverdienstkreuz und wurde von der Bundeskanzlerin zitiert.Wissenschaftsjournalismus als Bollwerk gegen Mythen
Auf dieser journalistischen Teildisziplin ruhen einige Hoffnungen – vor allem, weil alternative Fakten und Verschwörungsmythen schon seit einigen Jahren zu gesellschaftlichen Entwicklungen und Kommunikationsweisen führten, die als bedenklich betrachtet werden. „Gibt man ihm die Mittel und die Spielräume, die er benötigt, kann der Wissenschaftsjournalismus ein Bollwerk gegen Desinformation sein – und ein Bollwerk gegen die Boulevardisierung“, schreibt Professor Dr. Tanjev Schulz vom Journalistischen Seminar der der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Selbst für den Wissenschaftsjournalismus unerreichbar bleiben allerdings Menschen, die jegliches Vertrauen in Medien verloren haben und diese bloß noch als Marionetten eines diffusen Feindes betrachten. In der Coronapandemie ist dieses Denken offenbar verbreiteter geworden, entsprechende Äußerungen salonfähiger. Da auch Personen aus der Mitte der Gesellschaft von Coronaskeptikern mobilisiert werden, steht die Befürchtung im Raum, Medien könnten den Anschluss an eine große Gruppe von Rezipienten verlieren. Ein Konzept zu finden, mit dem sie in die relativ geschlossenen Weltbilder zurückfinden, scheint schwer. Einige Medien versuchen es dennoch. Beispielsweise lädt die „Frankfurter Rundschau“ unzufriedene Leser dazu ein, mit dem Medium sachlich über mögliche Fehler zu diskutieren.Medical-Tribune-Bericht