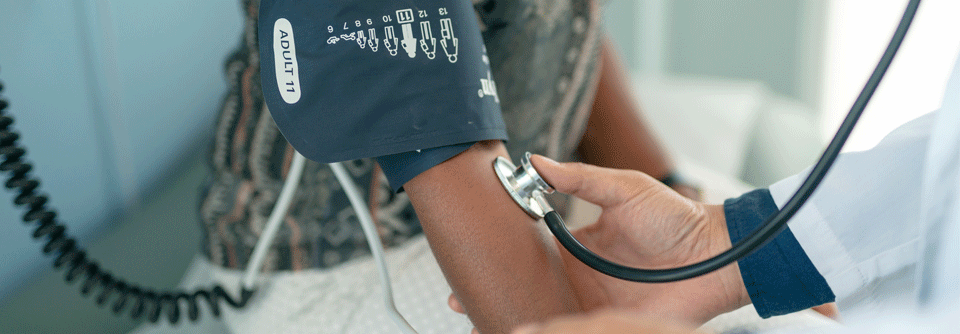Sexismus und Rassismus im Medizinstudium „Das ist nur die Spitze des Eisbergs“
 Diskriminierende Äußerungen bei Lehrveranstaltungen werden oft schweigend hingenommen. (Agenturfoto)
© iStock/skynesher
Diskriminierende Äußerungen bei Lehrveranstaltungen werden oft schweigend hingenommen. (Agenturfoto)
© iStock/skynesher
Im Medizinstudium treten immer wieder Machtgefälle zutage – man denke etwa an die Hierarchie in der Klinik oder die Abhängigkeit der Studierenden von der Bewertung durch Lehrpersonen. Manche Dozierende missbrauchen diese Macht, indem sie Studierende verbal erniedrigen oder gar körperlich übergriffig werden.
Neues Online-Portal gibt Opfern anonym eine Stimme
Zumindest sexistische und rassistische Grenzüberschreitungen werden seit Dezember 2021 durch das Online-Portal „Detect“ der Uni Freiburg sichtbar gemacht. Bundesweit können Betroffene in medizinischer Ausbildung schriftlich schildern, was vorgefallen ist. Das Projektteam sichtet die Einsendungen dann und stellt sie anonymisiert auf die Website.
Obwohl das Projekt erst seit rund vier Monaten existiert und noch nicht offensiv beworben wurde, gab es bereits über 50 Einsendungen, berichtet Julia Haller, Lehrende am Institut für Allgemeinmedizin der Uni Freiburg und Mitglied des Projektteams. „Ich vermute, dass die bisherigen Einsendungen nur die Spitze des Eisbergs sind.“ Sie habe den Eindruck, dass Rassismus und Sexismus im Studium allseits bekannte, aber oft hingenommene Probleme seien. Für viele Studierende würden sie zum „schlechten Ton“ in den Kliniken gehören. Aus Angst trauten sich Betroffene oft nicht, die Vorfälle bei entsprechenden Beauftragten der Universitäten zu melden.
Zitate der Einsendungen
Studierende zur kritischen Reflexion befähigen
Der Bundesverband der Medizinstudierenden fordert eine systematische Erfassung der Diskriminierung im Studium. Zudem müssten diskriminierungskritische Kompetenzen vermittelt werden. Denn in der Lehre werde Diskriminierung nicht nur ausgeübt, sondern auch reproduziert. Und um dies zu erkennen, bräuchten die Studierenden die Fähigkeit zur Reflexion. Die Betroffenen stünden zudem nicht selbst in der Verantwortung. Diese liege bei den übergriffigen Personen und bei Gesellschaft, Politik und Gesundheitssystem.Diskriminierung in der Praxis
- Sich um die korrekte Aussprache von Namen bemühen.
- Betroffenen von struktureller Diskriminierung zuhören und ihnen die Erfahrungen nicht absprechen.
- Sich in Teamfortbildungen mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen auseinandersetzen (z.B. Antidiskriminierungstrainings besuchen).
- Qualitätszirkel zum Thema strukturelle Diskriminierung entwickeln.
- Eine Kultur etablieren, in der es möglich ist, eigene Handlungen zu reflektieren und sich gegenseitig zu stärken und zu korrigieren.
- Personen mit Vor- und Nachnamen ansprechen statt mit Frau oder Herr, um auch nicht-binäre Personen einzuschließen.
Medical-Tribune-Bericht