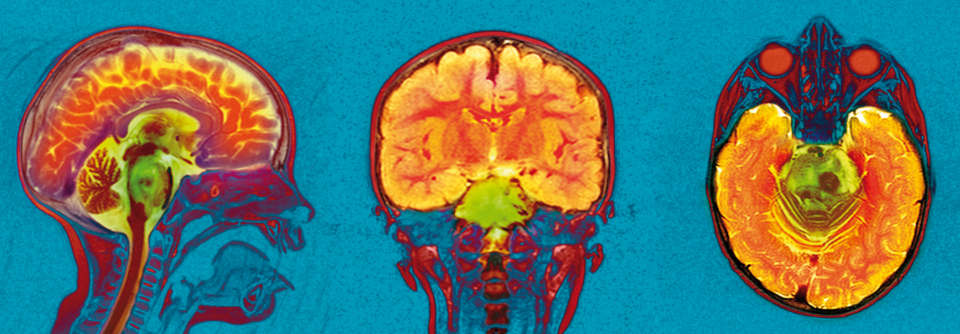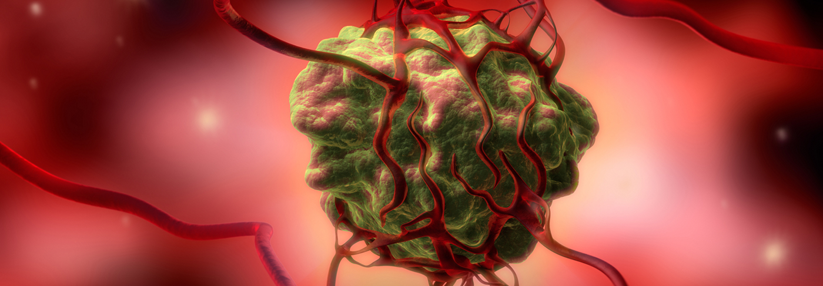Seltene Krebserkrankungen Späte Diagnosen und unzureichende Forschung
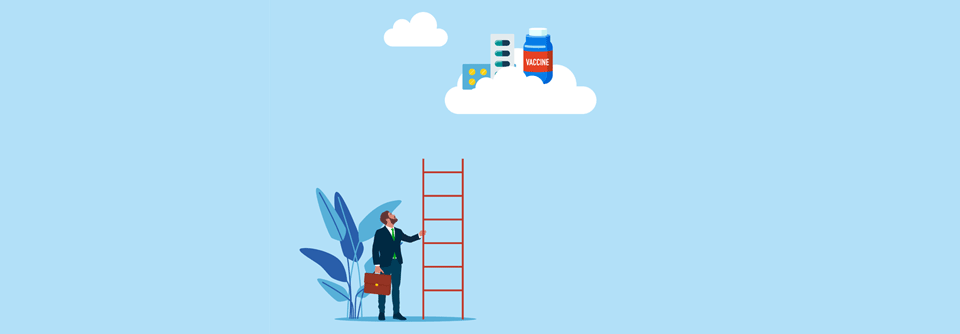 Viele Initiativen, einschließlich des Aktionsbündnisses NAMSE, setzen sich für bessere Versorgung seltener Erkrankungen ein.
© Vadym – stock.adobe.com
Viele Initiativen, einschließlich des Aktionsbündnisses NAMSE, setzen sich für bessere Versorgung seltener Erkrankungen ein.
© Vadym – stock.adobe.com
Seltene Krebserkrankungen (Rare Cancers) betreffen etwa 24 % allen Krebsneuerkrankungen pro Jahr. 198 Rare Cancers sind laut RARECAREnet database bekannt und in Europa leben zirka 5,1 Millionen Menschen mit einer seltenen Krebserkrankung. Dazu gehören Krebsarten wie etwa das Weichteilsarkom: Ungefähr 4.600 Männer und Frauen erhalten jährlich diese Diagnose. Beim Darmkrebs sind es pro Jahr um die 54.800 Neuerkrankungen, Lungenkrebs trifft etwa 56.700 Patient:innen pro Jahr.
Betroffene und Patientenorganisationen beklagen sich seit Jahren über späte Diagnosen, Mangel an Spezialisten und unzureichende Forschung, u. a. weil kleine Patientenkollektive den Aufbau von Studiengruppen erschweren. Das betrifft seltene Krebserkrankungen und andere seltene Erkankungen (SE) gleichermaßen.
Großer Fortschritt: Zentren für Seltene Erkrankungen
EURORDIS ist eine nicht-staatliche europäische Allianz, die sich für die Belange von Menschen mit SE einsetzt. Beim jährlichen Rare Barometer Survey (www.eurordis.org/rare-barometer) sammelt die Allianz Erfahrungen der Betroffenen mit den Erkrankungen. Im Fokus stehen u. a. Diagnosezeit, Versorgung, soziale Aspekte und Lebensqualität. Am Survey 2024 hatten sich 9.591 Menschen beteiligt, bei 6.136 Personen war die SE diagnostiziert, 662 von diesen kamen aus Deutschland. Im Schnitt berichteten die Betroffenen über 4,7 Jahre Wartezeit bis zu einer Diagnose. In 62 % der Fälle waren es fünf Jahre und mehr. Die aktuelle Umfrage läuft noch, im kommenden Jahr sollen dann die Ergebnisse veröffentlicht werden.
In Deutschland setzt sich das Nationale Aktionsbündnis für Menschen mit Seltenen Erkrankungen NAMSE schon seit 2010 für eine verbesserte Versorgung Betroffener ein. Unter anderem wurden so neue Strukturen in der Versorgung geschaffen, etwa die auf eine europäische Initiative zurückgehenden Zentren für Seltene Erkrankungen (ZSE). Heute gibt es über 30 dieser Einrichtungen deutschlandweit (se-atlas.de). Sie sind Anlaufstellen für Betroffene sowie betreuende Ärztinnen und Ärzte gleichermaßen.
Vergütungsmodelle sind bisher unzureichend
Diese gebündelte Expertise reicht allerdings längst nicht, um alle Versorgungsprobleme auszugleichen. Das NAMSE hat deshalb im September einen 10-Punkte-Plan 2026 zur Priorisierung von Maßnahmen veröffentlicht. Bis Ende 2026 will das Bündnis Vorschläge für ein Modell des sektorenübergreifenden Versorgungspfads und die koordinierte Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, dem niedergelassenen Bereich und den Sozialleistungsträgern entwickeln. Im Fokus steht auch die Definition eines strukturierten Datenelements zu SE in der elektronischen Patientenakte, um dieses z. B. in Arztbriefen oder in der Europäischen Patientenkenntnisakte ePKA nutzen zu können. In den nächsten zwei Jahren will das NAMSE weiterhin die Entwicklung der Register für seltene Erkrankungen genauer betrachten. Dabei sollen nationale und europäische Initiativen berücksichtigt werden.
Im EURORDIS Barometer 2024 berichteten mehr als 60 % der Familien mit SE über erhebliche finanzielle Einbußen, mehr als 40 % über psychische Belastungen und soziale Isolation. Auch in diesen Feldern sieht NAMSE Handlungsbedarf. Menschen mit einer SE oder einem begründeten klinischen Verdacht sollen bei der Organisation von Heil- und Hilfsmitteln, Pflege, Rehabilitation und sozialem Unterstützungsbedarf mehr Hilfe erhalten.
Der Frage, welche Infrastruktur für eine bessere Versorgung der seltenen Krankheiten benötigt wird, ging die Initiative change4RARE nach, der u. a. Prof. Dr. Christof von Kalle, tätig als Leiter des Bereichs Klinisch-Translationale Forschung am Berlin Institute of Health (BIH) der Berliner Charité und aktiver Unterstützer der Nationalen Dekade gegen den Krebs, angehört.
Kritisch heben die Expert:innen auch die unzureichenden Mittel für die ZSE hervor. Vier Millionen Betroffene stünden einer lückenhaften Versorgung gegenüber, weil 38 % der ZSE ausschließlich über Pauschalen der Hochschulambulanzen und weitere 41 % über Mischvergütungen finanziert würden.
Als Lösung wird eine SE-Sonderpauschale vorgeschlagen sowie die Aufhebung mengenmäßiger Budgetgrenzen für telemedizinische Leistungen insbesondere bei den seltenen Erkrankungen. Laut der change4RARE-Betrachtung sind ebenso überregionale Vergütungsmodelle wichtig, die Zentren ermöglichten auch außerhalb ihres klassischen Einzugsgebiets zu beraten und zu begleiten.
Weitere Vorschläge sind:
- Interdisziplinär abrechenbare Fallbesprechungen – auch zwischen niedergelassenen Ärzt:innen, Klinikambulanzen und universitären Einrichtungen,
- Integration von Telemedizin in die Regelversorgung, z. B. über die Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung, über Versorgungspfade oder §140a SGB V,
- interoperable, datenschutzkonforme Plattformlösungen, an denen sich beteiligte Leistungserbringer anschließen können,
- verbindliche Regelungen zur Dokumentation telemedizinischer Leistungen, sodass Patient:innen Zugriff auf relevante Befunde erhalten. Weiterbehandelnde Ärzt:innen sollten unkompliziert Einsicht erhalten können, um Kontinuität in der Versorgung zu gewährleisten.
Quelle:
Aktionsbündnis NAMSE