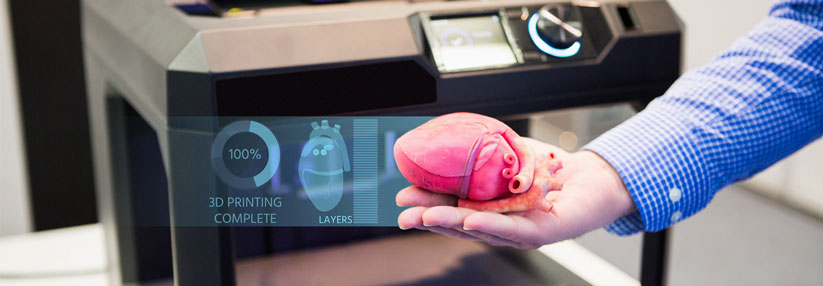Das Gesundheitssystem am Limit Gesundheitssystem: Reformideen vom Intensivmediziner für die Politik
 Wie kann das Gesundheitssystem vor dem Kollaps gerettet werden? Prof. Karagiannidis skizziert Reformen für Pflege, Notfall und Prävention.
© STOATPHOTO - stock.adobe.com
Wie kann das Gesundheitssystem vor dem Kollaps gerettet werden? Prof. Karagiannidis skizziert Reformen für Pflege, Notfall und Prävention.
© STOATPHOTO - stock.adobe.com
Das deutsche Gesundheitswesen droht in fünf bis zehn Jahren zu kollabieren, wenn sich nicht schnell Gravierendes ändert. Dieser Meinung ist der Pneumologe und Intensivmediziner Prof. Dr. Christian Karagiannidis.
Er ruft zu einem entschlossenen Reformkurs auf und stellt Lösungen vor.
"Der Herbst der Reformen muss kommen.“ Mit diesem Satz eröffnete Prof. Dr. Christian Karagiannidis seinen Vortrag beim 11. Barmer-Länderforum in Wiesbaden. Der Leiter des ECMO-Zentrums der Kliniken der Stadt Köln ist überzeugt: Ohne tiefgreifende Reformen bleibt das Gesundheitswesen in einer Kosten- und Strukturkrise. Demografischer Wandel, Personalmangel sowie Finanzdruck werden das System in den kommenden Jahren immer stärker beanspruchen – bis zur Gefahr des Zusammenbruchs.
Prof. Karagiannidis nutzte die Formulierung „Wenn ich Gesundheitsminister wäre …“ zwar nur einmal, doch sein Vortrag war von genau diesem Gedanken getragen: Wie müsste ein Gesundheitsminister handeln, um das System zu retten? Immer wieder sagte er Sätze wie „Ich würde das so machen“ oder „Das hätte ich niemals genehmigt“.
Zu vielen Behandlungen wird zu wenig Zeit gewidmet
Im internationalen Vergleich weist das deutsche System eine auffallend hohe Zahl von Arzt-Patienten-Kontakten sowie Krankenhausaufenthalten auf, weiß Prof. Karagiannidis. 64 % der über 85-Jährigen werden mindestens einmal pro Jahr stationär behandelt. Mit fünf bis zehn Minuten ist die durchschnittliche Zeit pro Patientin oder Patient in der Hausarztpraxis gering. In skandinavischen Ländern liegt sie durchschnittlich bei 20 bis 30 Minuten. Was daraus folgt, ist ein System, das zwar viel leistet, aber Ressourcen suboptimal nutzt und die Aufmerksamkeit für komplexe Fälle schwächt.
Der Personalmangel verschärft das Problem. Das zeigt sich vor allem in der Pflege. Dort ist der Altersdurchschnitt besonders hoch: Nur 13 % der Fachkräfte sind jünger als 30 Jahre, 31 % über 55 Jahre alt. Trotz internationaler Rekrutierung bleibt die Lücke groß. Auch in der hausärztlichen Versorgung stehen Engpässe bevor: 41 % der Hausärztinnen und -ärzte sind über 60 Jahre alt.
Wie auch andere Industrienationen hat Deutschland das Problem, dass die Bevölkerung zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs schrumpfen wird. Bis 2035 werden jährlich 500.000 Menschen in Rente gehen, für die keine Erwerbstätigen nachkommen. Außerdem sinkt die allgemeine Gesundheitskompetenz der Bevölkerung.
Finanziell spitzt sich die Lage ebenfalls zu. Die Klinikausgaben stiegen zuletzt um 10 % im Jahr, obwohl die Fallzahlen stagnieren. Der Rettungsdienst kostet GKV, Länder und Kommunen mittlerweile rund zehn Milliarden Euro jährlich, Tendenz steigend. In stationäre Strukturen fließen Milliardensummen, während der ambulante Bereich unterfinanziert bleibt, so Prof. Karagiannidis. Langfristig drohe ein Anstieg der Sozialabgaben bis auf 50 % – eine Belastung, die für die Volkswirtschaft gefährlich werde.
Notfallreform würde schnell Wirkung zeigen
Prof. Karagiannidis’ Reformagenda sieht kurz-, mittel- und langfristige Prioritäten vor. Kurzfristig müsse insbesondere die Notfallversorgung reformiert werden. „Die Notfallreform hätte eine echte Wirksamkeit, die auch deutlich schneller greift als bei der Krankenhausreform.“ Das bedeute eine Integration der Rufnummern 112 und 116 117, den Aufbau integrierter Notfallzentren an Kliniken sowie eine Umstellung der Vergütung des Rettungsdienstes auf medizinische Leistungen statt lediglich der Transportfinanzierung. Auch bedürfe es eines besseren Verständnisses von Notfällen in der Bevölkerung. „Ein Drittel der Notfallpatientinnen und -patienten wird nur mit einem leichten bis moderaten Schweregrad der Verletzung eingeliefert.“ Schon kleine Reduktionen bei den stationären Aufnahmen könnten hohe Einsparungen generieren.
Auch bei der Pflege brauche es einen Strukturwandel, weg von stationären Aufenthalten, hin zu mehr ambulanter Versorgung. Prof. Karagiannidis empfiehlt sektorenübergreifende Pflegepfade sowie statt der Selbstkostendeckung eine Vorhaltefinanzierung, ergänzt durch Tagespauschalen.
Mittelfristig sei auch die Digitalisierung entscheidend. Während Kliniken durch das Krankenhauszukunftsgesetz Fortschritte gemacht hätten, hinke der ambulante Bereich hinterher. Prof. Karagiannidis empfiehlt eine einheitliche Plattform, die Behandlungsdaten für alle Sektoren zugänglich macht, etwa wie es Dänemark oder Katalonien vormachen. Solche Systeme ermöglichten enorme Effizienzgewinne und Qualitätsverbesserungen.
Eine langfristige Lösung biete das Pflegekompetenzgesetz. Medizinische Fachkräfte wie Physician Assistants, die auf Delegation hin tätig werden, sowie eigenverantwortliche Pflegefachkräfte wie Community Health Nurses entlasten das System. In England gehöre es z. B. schon lange zum medizinischen Alltag, dass ausschließlich Pflegefachkräfte Patientinnen und Patienten impfen. Richtig wirksam werde dieses Instrument hierzulande jedoch erst in einer Dekade, vermutet Prof. Karagiannidis.
Auch die Prävention müsse man stärker fördern. „Bei all den Reformanstrengungen in den nächsten Jahren müssen wir vor allem darauf abzielen, dass wir gesünder alt werden“, so der Pneumologe und Intensivmediziner. Ein Schlüssel dafür sei körperliche Aktivität. Ferner sei es wichtig, Tabak, Alkohol und Zucker höher zu besteuern. Aus anderen Ländern wisse man, dass dies direkt zu einer niedrigeren allgemeinen Gesundheitsbelastung führe. Mehreinnahmen aus Steuererhöhungen könnten über den Gesundheitsfonds für präventive Maßnahmen genutzt werden.