Hauptstadtkongress Innovation? Stagnation!
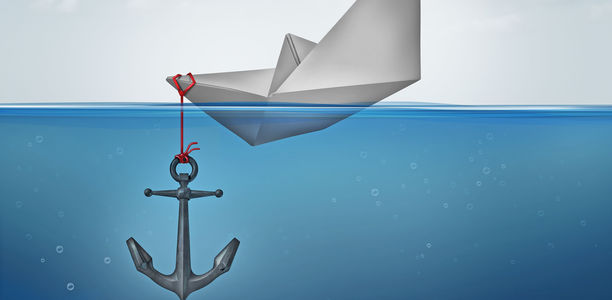 © freshidea - Fotolia
© freshidea - Fotolia
Der "Blick in den Rückspiegel" erleichtere die Sicht nach vorne, so präsentierte Prof. Dr. Bertram Häussler vom IGES-Institut in seinem Einführungsvortrag am Beispiel des Kampfes gegen die koronare Herzerkrankung, wie Investitionen zu Innovationen und schließlich zu drastischem Abfallen der Sterblichkeit führen können. Dieser Prozess sei jedoch langfristig, betonte Häussler: "Der Erfolg hat sich erst nach Jahrzehnten eingestellt." Er mahnte deshalb: "Forschung und Entwicklung brauchen Mut." Die Politik müsse so gestalten, "dass der Prozess nicht abgewürgt wird." Gerade hier liegt das Problem, da die wenigsten Politiker gefangen im 4-Jahres-Zyklus der Legislaturperioden über den Wahltag hinaus agieren.
Innovationen müssen die Lebensqualität fördern
Zur Eröffnung des Kongresses hatte Annette Widmann-Mauz, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, auf die Haltung der Bundesregierung hingewiesen, wonach "das Solidarsystem nur nützliche Innovationen finanzieren kann". Der Begriff Innovation sei "kein Gütesiegel an sich, sondern der Nutzen müsse evidenzbasiert nachgewiesen werden", so Widmann-Mauz. Die Innovationsstrategie der Bundesregierung sehe dafür 3 Voraussetzungen: Erstens müssten "echte Innovationen einen wirklichen Fortschritt für Lebensqualität und Lebenschancen" bringen. Zweitens müssten sich Innovationen am Versorgungsbedarf orientieren. Und drittens dürften wirkliche Innovationen "keine Eintagsfliegen" sein.
Wie zerstritten die Große Koalition im Bereich der Gesundheitspolitik ist, zeigte sich erneut beim Thema Finanzierung. Dr. Karsten Neumann vom IGES-Institut stellte zur Einführung in die Diskussionsrunde einen Mittelbedarf von 213,4 Milliarden Euro allein für die gesetzliche Krankenversicherung fest und verwies gleichzeitig auf die Verteilung im Gesundheitsfonds, der den Wettbewerb der Krankenkassen einebne. Mittels Zusatzbeitrag richte sich der Fokus der Versicherten allein am Preis aus. Hier habe sich seit 2008 nichts geändert, außer dass bei den Kassenwechslern die Entscheidungsgrundlage inzwischen zu 70 % auf den Beitragssatz und geldwerte Vorteile verengt sei. In der Diskussion um den Risikostrukturausgleich sei der Qualitäts-wettbewerb aktuell nur eingeschränkt umsetzbar. Dieser These stimmten die Gesundheitsexperten von der CDU, Maria Michalk, ebenso wie Hilde Matheis von der SPD und Maria Klein-Schmeink vom Bündnis 90/Die Grünen uneingeschränkt zu.
Riskante Rezepte
Bei der Remedur gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. So will die Gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU die Solidarische Grundversorgung unbedingt im Rahmen der Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben halten und deshalb "in dieser Legislaturperiode den Morbi-RSA nicht mehr aufmachen, um an irgendwelchen Schräubchen zu drehen", mit ungewissem Ausgang. Die Krankenkassen sollten allerdings mehr Geld mit Vermeidung von Krankheiten und an der Prävention verdienen und beim Ausbau der Satzungsleistungen für mehr Transparenz sorgen. Am Zusatzbeitrag werde seitens der Union festgehalten. Die Neuauflage der Patientenquittung sorge für mehr Kostenbewusstsein. Diametral dagegen ist hier Hilde Mattheis, die den Zusatzbeitrag am liebsten sofort abschaffen würde. Nur der Koalitionsvertrag halte die SPD von der Einführung der Bürgerversicherung ab. Die Arbeitgeber will Mattheis in die Verantwortung zurückholen. Mit diesem Anliegen ist sie sich einig mit Klein-Schmeink, die den Zusatzbeitrag ebenfalls ablehnt, den Preiswettbewerb als "Irrweg" betrachtet, "weil er die Solidarität aushöhlt" und die Krankenkassen von einer guten Versorgung abhalte. Sie will mit neuen Konzepten für Chroniker und Ältere "vor Ort" die Situation verbessern. Dies könne nur durch die Einführung einer obligatorischen Bürgerversicherung für alle erfolgen. Die Kritik einer Einheitsversicherung für alle wischt die Gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen mit dem Hinweis vom Tisch, dass es für die Versicherten der PKV noch eine Übergangsphase geben werde. Die "Restkollektive" würden nicht gegen ihren Willen rausgetrieben. Michalk warnte demgegenüber: Kostensteigerungen in der GKV würden mit dem Ende der PKV unvermeidbar.
Anspruchsdenken der Versicherten zurückschrauben
Die Einheitsversicherung verteuere das deutsche Gesundheitssystem. Mattheis glaubt zwar ebenfalls nicht an den Lösungsansatz für das Finanzierungsproblem durch eine Ausgabensenkung, schon aufgrund des demographischen Wandels. Aber der gewachsene Anspruch auf eine flächendeckende Versorgung bringe eben Kostensteigerungen, die im Interesse des sozialen Friedens und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in Kauf zu nehmen seien. Die Gesundheitswirtschaft sollte sich eine Fortsetzung der Aufspaltung deshalb gut überlegen. Mit einem Bündel von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung will Michalk das Finanzierungsproblem von der Diskussion um die Beteiligung der Arbeitgeber an den Zusatzbeiträgen abkoppeln. Das Anspruchsdenken der Patienten müsse zurückgeschraubt werden. Bessere Diagnose-, Zweitmeinungsverfahren und sektorenübergreifende Versorgungsmodelle brächten Einsparmöglichkeiten.
Hoher Patientenandrang lockt keine jungen Hausärzte
Wie diese Modellprojekte in die Regelversorgung übergeleitet werden, dazu braucht es längere Erfahrung und vor allem erneut Geld. Woher die Mittel dafür kommen sollen, blieb am Ende erneut unbeantwortet und in den Schlagwortkaskaden der Diskutanten hängen. Ein Lichtblick in der Schlussrunde ist, dass sich zumindest in der aktuellen Koalition die Erkenntnis breit macht, dass junge Hausärzte nicht dorthin gehen, wo die Versorgungsstrukturen bereits so angespannt sind, dass die Kollegen mit dem Patientenandrang nicht mehr zurechtkommen, so Michalk. Auch Mattheis will deshalb der kleinräumigen Bedarfsplanung unter Einbeziehung der Kommunen und örtlichen Arbeitgeber größeres Augenmerk schenken. Eine inflationäre Diskussion über Innovation endet sonst nur in völliger Lähmung und Stagnation.
Hans Glatzl
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2016; 38 (13) Seite 36-39
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf doctors.today publiziert.


