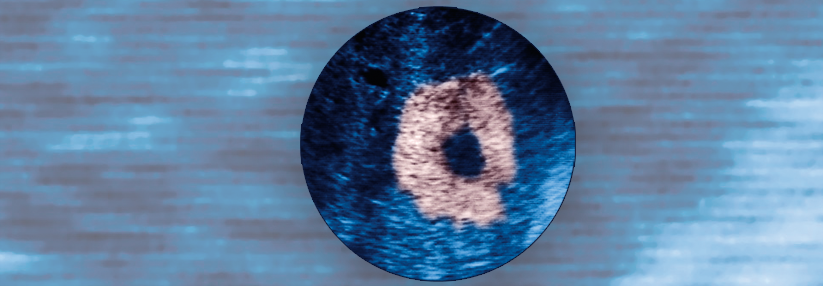
Auch Erkrankungen mit Resistenzen gegen BTK-Inhibitoren sprechen auf neue Substanzklasse an
 BTK-Degrader bieten eine neue Hoffnung bei B-Zell-Malignomen.
© peopleimages.com – stock.adobe.com
BTK-Degrader bieten eine neue Hoffnung bei B-Zell-Malignomen.
© peopleimages.com – stock.adobe.com
Die bisher entwickelten und zugelassenen BTK-Inhibitoren sind hocheffektiv und haben die Therapie vor allem der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL), aber auch des Morbus Waldenström erheblich vorangebracht. Nachteile betreffen unter anderem die Entwicklung von Resistenzen aufgrund von Mutationen, erläuterte Dr. Lydia Scarfò, Università Vita-Salute San Raffaele, Mailand.1 Aus diesem Grund entwickelten Forschende BTK-Degrader: Sie binden auf einer Seite an das BTK-Molekül und auf der anderen an die E3-Ligase des Proteasom-Komplexes. Dadurch wird das BTK-Protein in den Proteasom-Abbauweg geschleust, was letztlich zum Untergang der Lymphomzellen führt.
Der BTK-Degrader BGB-16673 ist oral bioverfügbar und liquorgängig (s. Kasten). Erstmals klinisch erprobt wurde die Substanz in der Phase-1-Studie CaDAnCe-101, an der Patient:innen mit einer Vielzahl rezidivierter oder refraktärer B-Zell-Tumoren teilnahmen.
Dr. Scarfò präsentierte eine Kohorte von 66 Personen mit CLL oder kleinem lymphozytischem Lymphom (SLL), die zuvor bereits mindestens zwei Therapien erhalten haben mussten (im Median vier), darunter einen BTK-Inhibitor. Sie erhielten BGB-16673 in verschiedenen Dosierungen von 50 mg bis 600 mg oral einmal täglich. Primäre Endpunkte waren wie in Phase 1 üblich Sicherheit und Verträglichkeit, als wichtiger sekundärer Endpunkt diente die Gesamtansprechrate. Die Kohorte hatte ein molekular- und zytogenetisches ungünstiges Profil: Rund zwei Drittel wies eine Deletion 17p und/oder TP53-Mutationen auf, und 77,6 % unmutiertes IGHV.
Nach median 15,6 Monaten waren bei 60,6 % Nebenwirkungen vom Grad 3 oder höher registriert worden, am häufigsten Neutropenien (24 %) und Pneumonien (11 %). Vorhofflimmern vom Grad 1 bzw. 2 trat in zwei Fällen auf, im Kontext von Infektionen und einem Progress. Bemerkenswert waren weiter eine Subarachnoidalblutung vom Grad 1 sowie eine subdurale Blutung vom Grad 3. In neun Fällen mussten die Verantwortlichen die Therapie aufgrund von Nebenwirkungen abbrechen.
Präklinische Ergebnisse
In präklinischen Modellen von B-Zell-Lymphomen führte BGB-16673 zum Abbau der Wildtyp- wie auch der mutierten Formen der Kinase. Das betraf gleichermaßen BTK-Proteine, die sowohl gegen kovalent als auch gegen nicht-kovalent bindende BTK-Inhibitoren resistent sind.
Schnelles Ansprechen, gute Verträglichkeit
Die ORR in der Gesamtkohorte betrug 84,8 % und 93,8 % mit der 200-mg-Dosierung, die für die Expansionsphase zugelassen wurde. Darunter erzielten allerdings nur drei Patient:innen bzw. eine Person eine CR. Die mediane Expositionsdauer belief sich mit der 200-mg-Dosierung auf 16,2 Monate; das Ansprechen erfolgte schnell, nach median 2,9 Monaten. Die Höhe der Ansprechrate war unabhängig von der Dosierung, von der Art der Vorbehandlung sowie von genetischen Prognosemarkern und BTK-Mutationen. Die Rate des progressionsfreien Überlebens nach zwölf Monaten betrug 77,4 %.
Eine weitere Kohorte, die Prof. Dr. Anna Maria Frustaci, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguard, Mailand, vorstellte, bestand aus stark vorbehandelten Patient:innen mit Waldenström-Makroglobulinämie.2 Häufigste therapieassoziierte Ereignisse umfassten Neutropenie (39 %, davon 31 % ≥ Grad 3) und Blutergüsse (31 %, alle Grad 1/2). Es gab keine Fälle von Vorhofflimmern, schweren Blutungen, schweren Neutropenien oder Pankreatitiden. Zwei Personen brachen die Behandlung wegen Nebenwirkungen ab.
Die Autor:innen konnten 32 Personen auswerten. Die ORR betrug 84,4 %, mit 31,3 % sehr guten partiellen Remissionen. Die IgM-Titer fielen rasch nach Beginn der Therapie ab. Im Median sprachen die Teilnehmenden nach einem Monat erstmals an und auch hier war das Ansprechen unabhängig von Vorbehandlung und Mutationen. Das mediane PFS ist noch nicht erreicht.
In einer bereits laufenden Phase-2-Studie wollen die Forschenden die Wirkung von BGB-16673 beim rezidivierten/refraktären Morbus Waldenström weiter evaluieren, schloss Prof. Frustaci. Zur CLL sind Phase-2- und Phase-3-Studien im Gange, wie Dr. Scarfò berichtete.
Quellen:
1. Scarfò L et al. EHA 2025; Abstract S158
2. Frustaci AM et al. EHA 2025; Abstract S231
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).

