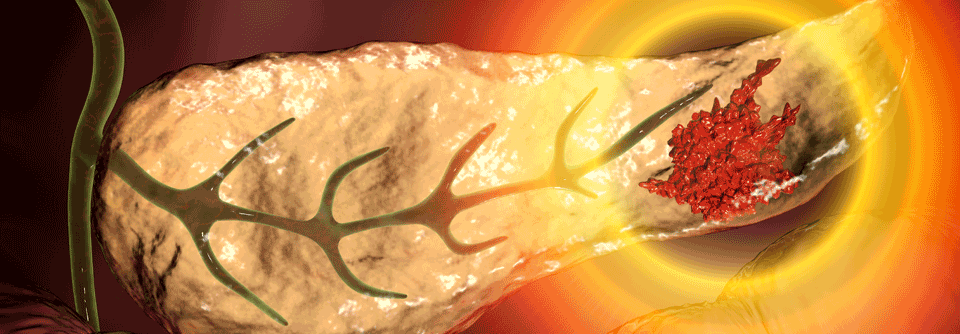Besser leben unter Sotorasib plus Panitumumab?
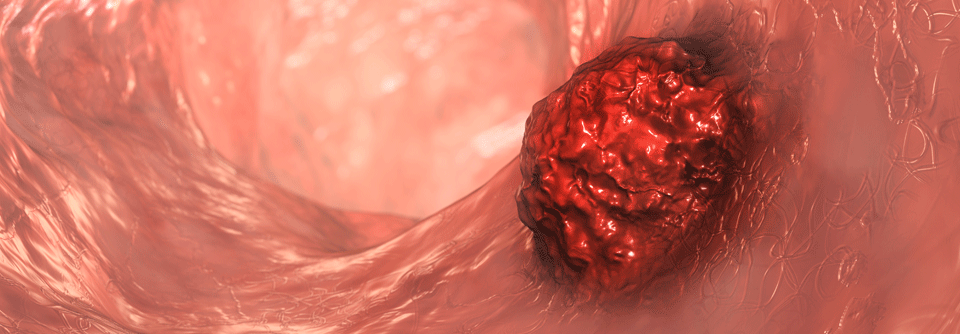 Sotorasib wirkt zielgerichtet gegen KRASG12C-mutierte Tumoren.
© Dr Microbe - stock.adobe.com
Sotorasib wirkt zielgerichtet gegen KRASG12C-mutierte Tumoren.
© Dr Microbe - stock.adobe.com
An der internationalen Phase-3-Studie CodeBreak300 nahmen 160 Personen mit einem KRASG12C-mutierten chemorefraktären metastasierten kolorektalen Karzinom teil. Sie hatten nach einer Chemotherapie mit Fluoropyrimidin, Oxaliplatin und Irinotecan ein Tumorrezidiv erlitten.1 Zwischen 2022 und 2023 beteiligten sich 67 Kliniken in 13 Ländern, berichtet das Team um Prof. Dr. Dominik Paul Modest von der Charité – Universitätsmedizin Berlin. KRASG12C-mutierte kolorektale Karzinome gelten als aggressive Tumoren, bieten jedoch einen Ansatzpunkt für eine gezielte Therapie mit Sotorasib, einem spezifischen und irreversiblen KRASG12C-Inhibitor. Die hohe Sotorasib-Dosis in Kombination mit Panitumumab verlängerte das mediane PFS mit 5,6 Monaten vs. 2 Monate im Vergleich zur Standardtherapie signifikant (HR 0,48; 95%-KI 0,30–0,78; p = 0,0047).
Nun gingen die Forschenden der Frage nach, inwiefern sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Erkrankten im Behandlungsverlauf veränderte. Hierzu objektivierten sie vor und während der Therapie regelmäßig mithilfe validierter Fragebögen folgende Patient Reported Outcomes (PRO): Fatigue, Schmerzen, den allgemeinen Gesundheitszustand/die Lebensqualität sowie die körperliche Funktion.
Studiendesign
Gemäß Randomisierung nahmen je 53 Teilnehmende täglich Sotorasib in hoher bzw. niedriger Dosis oral ein. In beiden Gruppen wurde zusätzlich zweiwöchentlich Panitumumab intravenös verabreicht. Die 54 Personen der Kontrolle erhielten dagegen eine orale Standardtherapie, bestehend aus Trifluridin/Tipiracil oder Regorafenib.
Nach neun Wochen absolvierten 82 %, 76 % bzw. 88 % der Patient:innen aus den drei Studienarmen die Befragung. Zu diesem Zeitpunkt zeichneten sich in beiden Sotorasibgruppen günstige Effekte bezüglich aller genannten PROs ab. Angesichts dieser Beobachtungen halten die Forschenden insbesondere die Kombination aus hoch dosiertem Sotorasib und Panitumumab für eine vielversprechende neue Option.
Explorativcharakter und Datenmenge als Kritikpunkte
Prof. Dr. Dr. Lars Henrik Jensen von der Universitätsklinik Süddänemark in Vejle sieht die Ergebnisse der CodeBreak300-Studie dagegen etwas weniger optimistisch.2 Krebskranke wünschen sich zwei Dinge, sagt er: Länger zu (über)leben und besser zu leben. Ein längeres OS gewährleistet die Kombination aus Sotorasib und Panitumumab nicht – in der Hochdosis-Gruppe reduzierte sie das Sterberisiko nicht signifikant (HR 0,70; 95%-KI 0,41–1,18; p = 0,20).
Leben die Betroffenen unter Sotorasib/Panitumumab zumindest besser als mit der Standardtherapie? Die PRO-Analyse fiel diesbezüglich zwar vielversprechend aus, meint der Kommentator, allerdings sieht er auch ihre Ergebnisse kritisch. Zum einen gibt er den Explorativcharakter der Auswertung zu bedenken. Ferner bemängelt er die relativ geringen Datenmengen, insbesondere in der Kontrollgruppe. Ein Attrition-Bias, also eine systematische Verzerrung der Ergebnisse durch das Ausscheiden von Teilnehmenden, sowie ein selektiver Reporting-Bias seien nicht auszuschließen.
Auch die Wahl der Kontrollintervention hält Prof. Jensen für unglücklich. Weder Trifluridin/Tipiracil noch Regorafenib hatten nämlich in den Originalstudien einen wesentlichen Überlebensvorteil gegenüber Placebo bei KRASG12C-mutierten Tumoren gezeigt, jedoch relativ häufig schwere Nebenwirkungen verursacht. Der Kommentator vermutet daher, dass in der Kontrollgruppe der CodeBreak300-Studie kaum krankheitsspezifische positive Effekte, dagegen hauptsächlich therapieassoziierte Toxizitäten auftraten. Er wirft zudem die Frage auf, ob nicht eine spezialisierte palliativmedizinische Versorgung die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patient:innen ähnlich oder sogar stärker verbessert hätte als Sotorasib/Panitumumab.
Eine Aufgabe von Onkolog:innen ist es, Krebskranke bei Behandlungsentscheidungen zu unterstützen, betont Prof. Jensen abschließend. Dazu gehöre auch, realistische Therapieziele zu definieren. Damit keine falschen Hoffnungen in die Kombination aus Sotorasib und Panitumumab gesetzt werden, müssen nun größere Studien mit einer angemesseneren Kontrolle folgen, meint er.
Quellen:
1. Modest DP et al. Lancet Oncol 2025; doi: 10.1016/S1470-2045(25)00352-3
2. Jensen LH. Lancet Oncol 2025; doi: 10.1016/S1470-2045(25)00411-5
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).