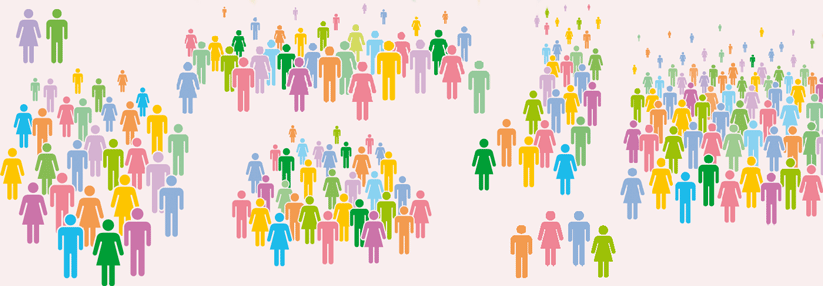DCM bei Kindern: KIT-Mutation als Schlüssel zur Therapie
 Aufgrund einer abnormalen Ansammlung von Mastzellen entstehen typische juckende Flecken.
© Science Photo Library / CID
Aufgrund einer abnormalen Ansammlung von Mastzellen entstehen typische juckende Flecken.
© Science Photo Library / CID
Die diffuse kutane Mastozytose (DCM) ist eine pädiatrische Sonderform der kutanen Mastozytose, bei der Mastzellen die gesamte Haut infiltrieren. Das kann zu Hautverdickung (Peau d’orange) oder Erythrodermie bis hin zur generalisierten Blasenbildung aufgrund von massiver Mastzelldegranulation führen. Meist liegt der Erkrankung eine Mutation im KIT-Gen zugrunde.
Klinische, molekulare und behandlungsbezogene Daten zur DCM sind aufgrund ihrer Seltenheit bisher Mangelware. Ein französisches Expertenteam um Dr. Paula Pernea von der Universität Paris Centre analysierte retrospektiv eine landesweite Patientenkohorte von 33 Kindern – 29 mit DCM und vier mit aggressiver systemischer Mastozytose (ASM). Letztere lässt sich bei diffus ausgeprägter kutaner Beteiligung klinisch nicht von einer DCM unterscheiden. Sämtliche Kinder wiesen ein kutanes Mastzellaktivierungssyndrom auf. Bei 13 von ihnen waren im Krankheitsverlauf lebensbedrohliche Komplikationen aufgetreten (inkl. Anaphylaxie Grad 3 und 4). Knapp 55 % der Teilnehmenden waren männlich, der Altersdurchschnitt beim Auftreten der ersten klinisch signifikanten Anzeichen lag bei 2,2 Monaten. Neun Kinder hatten krankheitstypisch eine massive Blasenbildung entwickelt.
Im Vergleich zu den Kindern mit reinem DCM hatten jene mit ASM höhere Basistryptaselevel (109,8 μg/l vs. 40,9 µg/l). Alle vier zeigten in der genetischen Untersuchung außerdem eine Punktmutation im KIT-Gen an Position 816. In einer weiteren Gegenüberstellung zu bereits veröffentlichten Daten einer Kohorte mit makulopapulöser Mastozytose (MPCM; n = 211) hatten Kinder mit diffuser kutaner Form dagegen einen höheren mittleren Serumtryptase-Basiswert (47,5 µg/l vs. 7,4 µg/l), bei ihnen waren auch Anaphylaxien häufiger.
Etwa ein Fünftel der Patientinnen und Patienten benötigte eine frühe Systemtherapie. Abhängig von der KIT-Variante erhielten sie einen Tyrosinkinaseinhibitor (Imatinib, Midostaurin) oder den mTOR-Inhibitor Sirolimus. Die Behandlung begann im mittleren Alter von ca. sechseinhalb Jahren (80,8 Monate), wurde im Mittel vier Jahre fortgesetzt und im Allgemeinen gut vertragen. Von den 15 Betroffenen ohne Systemtherapie zeigten 13 über mehr als sechs Jahre eine spontane Regression. Ab einem Alter von median 34 Jahren wurden aus der Kohorte keine bullösen Hautläsionen mehr berichtet.
Antihistaminika können Schüben vorbeugen
Ansonsten wurden Betroffene mit Antihistaminika (Desloratadin), Montelukast, Cromoglicinsäure oder – während der Blasen-Flares – auch kurzfristig Glukokortikoiden behandelt. Topisch könnten Steroide bei Schüben zum Einsatz kommen sowie Antihistaminika gegen den Juckreiz und zur Schubprävention.
Das klinische Bild von pädiatrischen Patientinnen und Patienten mit DCM ist im Vergleich zu MPCM durch einen schwereren Phänotyp gekennzeichnet und geht mit einem höheren Risiko für Anaphylaxie einher. Deswegen rät die Autorengruppe, Betroffenen immer einen Adrenalinpen zu verschreiben. Allerdings geht die DCM schneller zurück als die makulopapulöse Variante. Da in der DCM-Kohorte auch einige Kinder mit aggressiver systemischer Mastozytose eingeschlossen waren, empfehlen sie zudem, bei einer diffusen Hautbeteiligung auf systemische Anzeichen wie eine Organomegalie oder die charakteristische KIT-Mutation zu achten.
Quelle: Pernea S et al. JAMA Dermatol 2025; doi: 10.1001/jamadermatol.2025.1488
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).