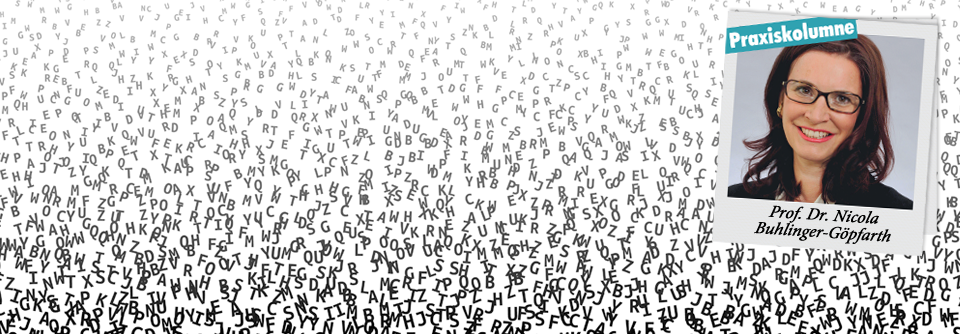Cartoon Kolumnen
Der Nocebo-Effekt des Nicht-Genderns
 Das generische Maskulinum verstärkt stereotype Vorstellungen, untergräbt die Autorität hochqualifizierter Kolleginnen und wirkt bis in die Wahrnehmung von Patienten und Patientinnen hinein.
© New Africa – stock.adobe.com
Das generische Maskulinum verstärkt stereotype Vorstellungen, untergräbt die Autorität hochqualifizierter Kolleginnen und wirkt bis in die Wahrnehmung von Patienten und Patientinnen hinein.
© New Africa – stock.adobe.com
Sprache ist mehr als nur Mittel zur Kommunikation. Sie prägt unser Denken, unsere Erwartungen – und, wie wir mittlerweile wissen, sogar unsere Heilung. Gerade in der Medizin, wo Placebo- und Noceboeffekte nicht nur statistische Größen, sondern klinische Realitäten sind, sollten wir deshalb genau hinschauen, was unsere Worte auslösen.
Ein klassisches Beispiel aus meiner Assistenzzeit: Ich hatte zusammen mit einer sehr kompetenten Kollegin über eine Woche hinweg die ärztliche Versorgung einer Normalstation übernommen. Wir haben aufgeklärt, Blut abgenommen, Therapien initiiert, Angehörigengespräche geführt. Am Freitag war Chefvisite und als wir das Zimmer eines Patienten betraten, schaute er meinen Chef an und sagte – ohne jede Ironie, höchstens mit etwas Empörung in der Stimme: „Ich habe die ganze Woche keinen Arzt gesehen.“
Dieser Satz hat sich eingebrannt bei mir. Nicht weil er verletzend war – sondern weil er entlarvend war. In seinem Kopf war ein Arzt offenbar jemand anderes. Vielleicht größer. Vielleicht älter. Ganz sicher aber vor allem: männlich.
Das generische Maskulinum – also die sprachliche Konvention, mit „Arzt“ auch Ärztinnen „mitzumeinen“ – zeigt darin seine Nebenwirkungen. Es gaukelt Inklusivität vor, schafft aber exklusive Bilder. Und diese Bilder sind mächtig. Wenn Patientinnen und Patienten bei „der Arzt kommt gleich“ ein inneres Bild haben, das nicht zu der real erscheinenden Person passt, leidet die therapeutische Allianz. Und das hat handfeste Folgen: schlechtere Adhärenz, geringeres Vertrauen, geringerer Placeboeffekt. Oder sogar: ein Noceboeffekt, ausgelöst durch den Bruch mit einer sprachlich geprägten Vorstellung, auch wenn diese oft nur unbewusst vorhanden ist.
Wir wissen heute, dass die Erwartungshaltung einen enormen Einfluss auf den Therapieerfolg hat. Ob bei der Wirkung von Schmerzmitteln, der Verträglichkeit von Medikamenten oder sogar dem Resultat einer Operation: Was ich glaube, beeinflusst, wie mein Körper heilt. Wenn also unsere Sprache implizit suggeriert, dass nur „der Arzt“ behandelt – und nicht auch die Ärztin, die Assistenzärztin, die Fachärztin –, dann sabotieren wir unbewusst die Wahrnehmung der Realität und damit auch die Behandlung selbst.
„Warum gendern?“ höre ich oft – meist mit einem leichten Augenrollen. Doch diese Frage sollte umgedreht werden: Warum eigentlich nicht? Dass Menschen bei männlichen Berufsbezeichnungen tatsächlich eher an einen Mann denken, auch wenn ihnen das selbst gar nicht bewusst ist, zeigen mittlerweile zahlreiche Studien. Warum sollten wir also bei etwas so zentralem wie unserer Gesundheit an sprachlichen Bildern festhalten, die den Behandlungserfolg gefährden könnten?
Das generische Maskulinum ist in der Medizin kein rein grammatikalisches Problem. Es ist ein klinisches. Es verstärkt stereotype Vorstellungen, untergräbt die Autorität hochqualifizierter Kolleginnen und wirkt bis in die Wahrnehmung von Patienten und Patientinnen hinein. Wenn eine Ärztin nicht als solche erkannt wird, ist das kein sprachliches Missverständnis, sondern ein therapeutisches.
Gendern ist kein Selbstzweck. Es ist ein Versuch, Sprache näher an die gelebte Realität heranzuführen – und damit auch an eine Realität, in der die Behandlung erfolgreicher, die Kommunikation klarer und die Zusammenarbeit respektvoller werden kann.
Ein Arzt kommt ins Zimmer. Eine Ärztin auch. Und je nachdem, wie wir darüber sprechen, beeinflussen wir nicht nur das Bild im Kopf, sondern vielleicht auch den Verlauf der Krankheit.
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).