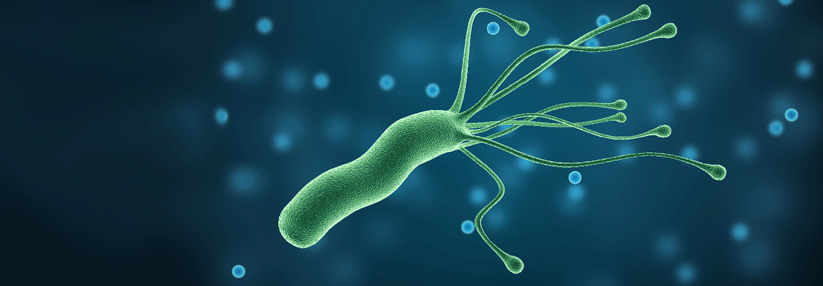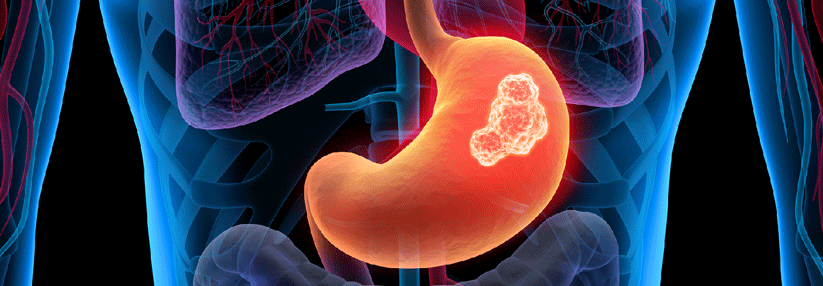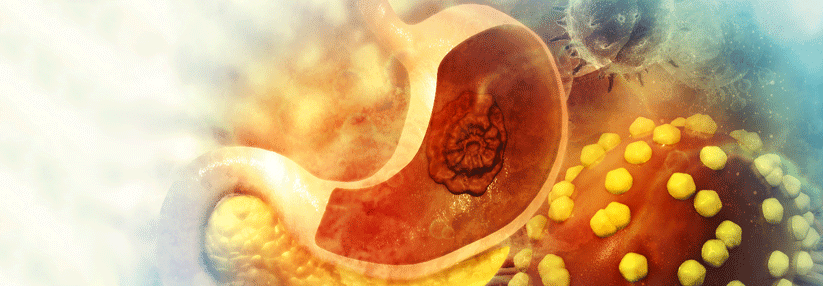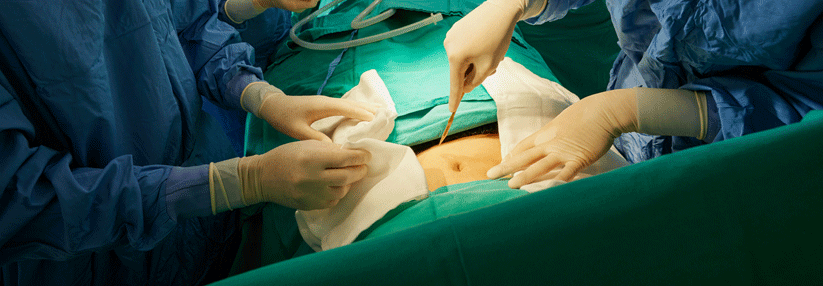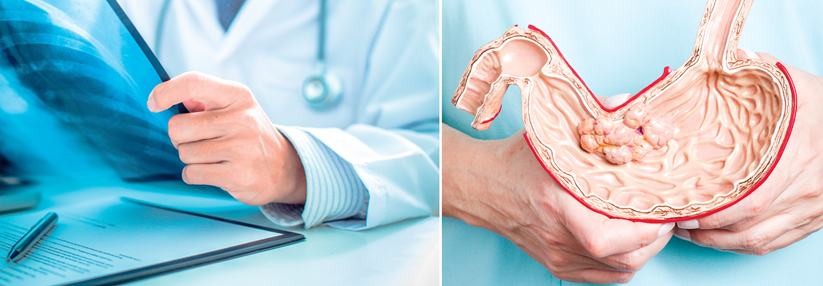Der Stellenwert zielgerichteter Optionen und CPI steigt
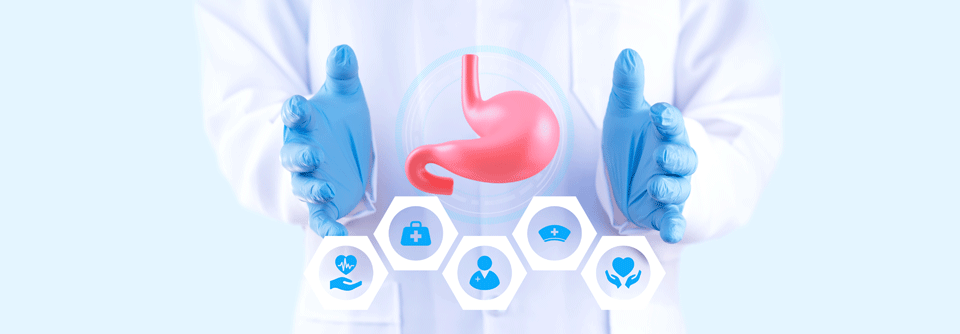 Neue Risikofaktoren, Wirkstoffe und Leitlinien verbessern zunehmend die Behandlung und Betreuung von Magenkarzinom-Patienten.
© Tom – stock.adobe.com
Neue Risikofaktoren, Wirkstoffe und Leitlinien verbessern zunehmend die Behandlung und Betreuung von Magenkarzinom-Patienten.
© Tom – stock.adobe.com
Was hat sich im Bereich der Magenkarzinomprävention geändert?
PD Dr. Yvonne Huber: Es haben sich vor allem die Empfehlungen zur Ösophagogastroduodenoskopie geändert. Wir können nicht empfehlen, die Allgemeinbevölkerung in Deutschland auf Magenkarzinome zu screenen. Allerdings wurde in die Leitlinie aufgenommen, dass diese Untersuchung inklusive einer Testung auf Helicobacter pylori bei asymptomatischen Personen ab 50 Jahren im Rahmen der Vorsorgekoloskopie erfolgen kann.
Patient:innen mit perniziöser Anämie sowie autoimmunbedingter atrophischer Gastritis sollen zukünftig engmaschig endoskopisch bioptisch überwacht werden. Auch Menschen mit CDH1- und CTNNA1-Mutationen sind Risikopersonen, die vermehrt diffuse Magenkarzinome entwickeln.
Prof. Dr. Markus Möhler: Wir wollen einen stärkeren Fokus auf die Prävention legen und müssen dazu Gastroenterolog:innen und Hausärzt:innen einbinden.
Welche Rolle spielt Helicobacter pylori dabei?
Prof. Möhler: Helicobacter pylori ist der wichtigste Risikofaktor, der in 90 % der Fälle für die Entstehung eines Magenkarzinoms verantwortlich ist.
Dr. Huber: Ärzt:innen sollen alle Personen auf Helicobacter pylori testen, die ein erhöhtes Magenkarzinomrisiko haben, sowie Verwandte ersten Grades von Erkrankten und Menschen, die in Hochprävalenzgebieten des Erregers oder Hochinzidenzgebieten des Tumors aufwuchsen. Hinzu kommen diejenigen, die eine fortgeschrittene, insbesondere korpusprädominante, atrophische Gastrititis aufweisen. Das Leitlinienkomitee hat neu aufgenommen, dass man nach endoskopischer Resektion eines frühen Magenkarzinoms oder Magenteilresektion die gesunde Schleimhaut biopsieren und auf den Erreger überprüfen soll. Allgemein empfiehlt sich bei allen Patient:innen, bei denen Helicobacter pylori nachgewiesen wurde, eine Eradikation.
Auf welche Biomarker sollten Ärzt:innen die Tumoren testen?
Dr. Huber: Bei therapiefähigen Erkrankten ohne Möglichkeit einer kurativen Resektion sollte man den Mikrosatellitenstatus (MSI), die PD-L1-Expression und den HER2-Status im Tumorgewebe testen. Eine HER2-Positivität kommt mit einer Häufigkeit von etwa 20 % vor. PD-L1-Positivität findet sich bei 40–60 % und eine Mikrosatelliteninstabilität mit 4–8 % sehr selten.
Sind neue systemische Behandlungsoptionen hinzugekommen?
Dr. Huber: Neu kam im letzten Herbst Zolbetuximab hinzu, ein spezifischer Antikörper gegen Claudin18.2, der in der palliativen Erstlinientherapie zugelassen ist. Auch die Expression dieses Moleküls sollten Behandelnde jetzt schon vor Beginn der Erstlinie testen. Wir wissen, dass etwa 30 % positiv für Claudin18.2 sind und prinzipiell Zolbetuximab erhalten könnten. Zusätzlich gibt es die Immuntherapie mit Tislelizumab, die ebenfalls die Zulassung in der palliativen First-Line erhielt. Beide konnten wir noch nicht endgültig in die Leitlinie aufnehmen, da die Zulassung zu spät kam.
Wer sollte laut der neuen Leitlinie zielgerichtete Pharmaka beziehungsweise Immuntherapien erhalten?
Dr. Huber: Wie bereits gesagt sollte man vor Einleitung der ersten Therapie die Biomarker testen und vom Ergebnis leiten sich die Empfehlungen ab. Zuerst wird geprüft, ob der Tumor positiv oder negativ für HER2 ist. Im ersten Fall können wir Trastuzumab zur Standard-Chemodublette hinzunehmen. Beträgt der PD-L1-CPS-Score ≥ 1 sollten Ärzt:innen zusätzlich Pembrolizumab geben.
Bei HER2-negativen Tumoren kommt Trastuzumab nicht infrage. Ab CPS 1 darf man die Chemotherapie um Pembrolizumab ergänzen oder ab CPS 5 um Nivolumab. Tislelizumab darf ebenfalls in Kombination mit Zytostatika first line eingesetzt werden. Voraussetzung ist hier ein TAP-Score von mindestens 5 %. Für PD-L1-negative Tumoren bleibt es bei der Dublette. Wenn mehr als 75 % der Zellen positiv für Claudin18.2 gefärbt sind, können Ärzt:innen Zolbetuximab in der Erstlinie geben, zusammen mit einer Chemotherapie wie FOLFOX.
Prof. Möhler: Vor Jahren starben metastasierte Erkrankte im Durchschnitt nach einem Jahr. Durch die zielgerichteten Behandlungen und Immuntherapien erreichen wir jetzt Zwei-Jahres-Überlebensraten bis 40 %. Mit einer nivolumabhaltigen Kombination lebte in CheckMate-649 nach fünf Jahren sogar jede:r fünfte bis sechste Betroffene. Unser Ziel ist, Kombinationstherapien möglich häufig einzusetzen, da wir wissen, dass Patient:innen langfristig mit guter Lebensqualität profitieren.
Und was, wenn Patient:innen mehrere Alterationen aufweisen?
Prof. Möhler: Es ist so, dass Zolbetuximab nur Claudin-positiven Betroffenen gegeben werden kann, die HER2-negativ sind, da die Zulassungsstudie HER2-positive Patient:innen ausschloss. Zusätzlich nahmen vor allem Personen teil, deren Tumoren einen niedrigen CPS aufwiesen. Unserer Ansicht nach käme eine claudingerichtete Therapie eher bei CPS-Scores unter 5–10 infrage. Für Patient:innen mit einem CPS > 5 plädieren wir zugunsten einer Kombination aus Chemo- und Immuntherapie.
Die Leitlinie lässt das letztendlich offen und Ärzt:innen müssen individuell abwägen. Dabei spielen die möglichen Nebenwirkungen wie Übelkeit und die Gesamtsituation eine Rolle. Zudem existieren Kontraindikationen gegen Immuntherapien, beispielsweise Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.
Was gilt, wenn eine kurative Resektion möglich scheint?
Prof. Möhler: Auch in nicht-metastasierten Stadien möchten wir den Mikrosatellitenstatus, den CPS und den HER2-Status kennen. Zu Claudin18.2 haben wir in der perioperativen Situation noch keine Daten. Es gibt bereits Befunde aus Phase-1- und Phase-2-Studien zur Kombination von Chemotherapien mit Immuntherapie oder zielgerichteten Wirkstoffen, insbesondere Trastuzumab oder Pertuzumab. Wir haben aber keine Zulassung in dieser Indikation.
Zur Immuntherapie in der perioperativen Situation wurden vor Kurzem auf dem ASCO die exzellenten Daten der MATTERHORN-Studie präsentiert. Diese zeigen, dass die Kombination FLOT mit Durvalumab das krankheitsfreie und ereignisfreie Überleben deutlich verbessert. Die Zulassung wird bis Anfang 2026 erfolgen.
Allgemein ist perioperativ der Stellenwert von FLOT gegenüber CROSS gestiegen …
Prof. Möhler: Ja, das stimmt eindeutig. In der ESOPEC-Studie hatte FLOT einen signifikanten Vorteil gegenüber der Radiochemotherapie. Man muss dazu anmerken, dass diese nur Tumoren des gastroösophagealen Übergangs einschloss. Es gab Kritik daran, dass der Bestrahlungsarm kein adjuvantes Nivolumab erhielt, obwohl dies zugelassen wäre. Zudem gab es eine Diskussion über die Qualität der Radiotherapie, da die Rate an pathologischen Komplettremissionen niedriger ausfiel als bisher publiziert. Nichtsdestotrotz handelt es sich um ein klares Signal, dass Patient:innen mit hohem Risiko für Fernmetastasen auf alle Fälle FLOT bekommen sollten.
Was hat sich im oligometastasierten Stadium geändert?
Dr. Huber: Standard ist die palliative Erstlinienkombination. Vor allem junge Betroffene können nach gutem Ansprechen zusätzlich lokal behandelt werden. Dies kann in Form einer Operation oder Ablation erfolgen. Mit diesem Ziel können bestimmte Patient:innen, die nach medikamentöser Therapie in Remission sind, an spezialisierte Zentren überwiesen werden. Kolleg:innen müssen jeden Fall vorher ausführlich in einer Tumorkonferenz besprechen, die Leitlinie gibt auch weitere Kriterien vor.
Welche weiteren wichtigen Änderungen gibt es im Hinblick auf Therapiekonzepte?
Dr. Huber: In den letzten Jahren zeigte sich, dass viele Erkrankte in gutem Allgemeinzustand die Möglichkeit bekommen sollten, eine Zweitlinienchemotherapie oder auch Drittlinienchemotherapie zu erhalten. Und dazu haben wir Empfehlungen aufgenommen.
Immuntherapienaive Personen mit mikrosatelliteninstabilen Tumoren können in der Zweitlinie Pembrolizumab bekommen. Wir haben auch in Abhängigkeit vom HER2-Status Trastuzumab-Deruxtecan beziehungsweise Tiperacil/Trifluridin als Optionen.
Weshalb haben Sie sich dafür entschieden, Elemente aus den S3-Leitlinien „Psychoonkologie“ und „Palliativmedizin“ aufzunehmen?
Prof. Möhler: Die Psychoonkologie und die palliative Versorgung waren in den letzen Jahrzehnten deutlich unterrepräsentiert. Wir haben bereits 2019 in die Leitlinie komplementäre Maßnahmen aufgenommen: Was kann der/die Betroffene selbst tun? Wie können wir das soziale Umfeld einbinden? Und wie sensibilisieren wir unsere Kolleg:innen für die persönliche Lebensgestaltung unserer Patient:innen? Viele Ärzt:innen haben immer noch die klare Vorstellung von Erstlinie, Zweitlinie und Drittlinie, die nacheinander durchgezogen werden. Erkrankte haben aber individuelle Lebensentwürfe, die wir mit in den Blick nehmen sollten.
Dr. Huber: In den Empfehlungen haben wir das Hinzuziehen der Palliativmedizin stärker in den Fokus gerückt. Gleiches gilt für supportive Therapien. Mediziner:innen sollten den Ernährungsstatus regelmäßig überprüfen und frühzeitig ein Ernährungsteam einbinden – übrigens auch perioperativ, also im kurativen Setting. Daten belegen, dass Patient:innen, die gut ernährt sind, aus der Operation in besserem körperlichen Zustand hervorgehen und weniger Komplikationen erleiden.
Das Leitlinienteam hat die Sarkopenie als neuen negativen Prognosemarker aufgenommen. Beim Staging gibt es eine „Kann“-Empfehlung dafür, diese in der CT zu messen. Auch in der palliativen Situation lässt sich der Skelettmuskelindex zur Bewertung der Prognose nutzen.
Welche wichtigen weiteren Fragen bleiben noch offen?
Dr. Huber: Wir diskutieren für die nächste Aktualisierung unter anderem, ob Chirurg:innen bevorzugt offen oder laparoskopisch operieren sollten und wie der Stellenwert minimalinvasiver robotergestützter Verfahren aussieht. Hinzu kommt die endgültige Bewertung der neuen Substanzen. Auch besteht noch Unklarheit über den perioperativen Einsatz von weiteren Checkpoint-Inhibitoren.
Prof. Möhler: Wie Frau Huber gesagt hat, bleiben offene Fragen zu vielen neuen Wirkstoffen. Zukünftig wird es Thema werden, ob Patient:innen mit Mikrosatelliteninstabilität überhaupt noch eine Chemotherapie brauchen. Außerdem ist die Frage nach einer limitierten Resektion für eine bessere Lebensqualität wichtig. Nicht zuletzt diskutieren Fachleute, ob es weitere präventionsrelevante Risikogruppen gibt. Wir wissen abgesehen von Helicobacter-Infektionen noch immer nicht genug darüber, wer Magenkrebs bekommen wird.
Quelle:
Interview: Lara Sommer
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).