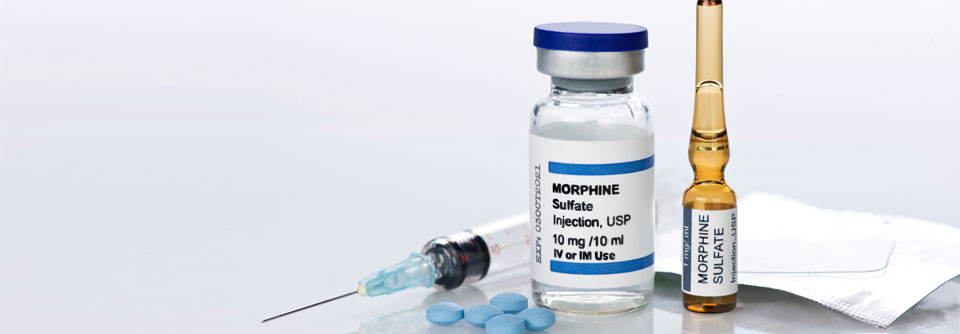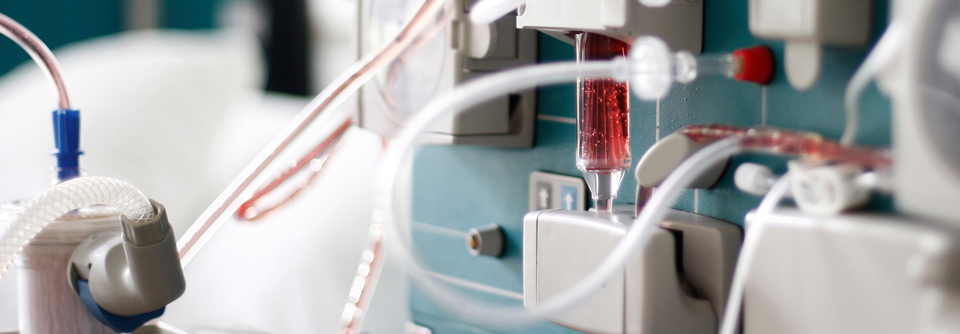Dialysetherapie: Lebenserhalt um jeden Preis?
 Im Interview reflektierte Dr. Pfrang, wie auf der Palliativstation im Franziskus-Krankenhaus mit dem Thema Dialyseabbruch umgegangen wird und wie die damit verbundenen ethischen Herausforderungen am besten bewältigt werden können.
© bannafarsai - stock.adobe.com
Im Interview reflektierte Dr. Pfrang, wie auf der Palliativstation im Franziskus-Krankenhaus mit dem Thema Dialyseabbruch umgegangen wird und wie die damit verbundenen ethischen Herausforderungen am besten bewältigt werden können.
© bannafarsai - stock.adobe.com
Bei natürlichem Verlauf eines Nierenfunktionsverlustes würden Patient:innen nach kurzer Zeit versterben. Eine Nierenersatztherapie kann jedoch ein längeres Leben erhalten. Die meisten Patient:innen sind trotz der Einschränkungen und Belastungen, die mit der Dialyse einhergehen, in ihrem Alltag dankbar für diese technische Möglichkeit und arrangieren sich mit der neuen Lebenssituation. Doch was, wenn aus medizinischer Sicht die Indikation nicht mehr gegeben ist oder die Patientin oder der Patient ausdrücklich den Abbruch der Dialyse wünscht?
Nephrologie und Palliativmedizin nah beieinander
Die Beendigung der Dialyse ist eine Entscheidung darüber, ob ein Mensch weiter mit Hilfe der Technik am Leben gehalten oder letztlich der natürliche Krankheitsverlauf und ein mögliches Versterben akzeptiert wird. Die meisten Menschen wünschen sich, dass dieser Prozess symptomarm, selbstbestimmt und würdevoll abläuft. Die Dialysetherapie könnte aus verschiedenen Gründen dem entgegenstehen. Damit steht die Frage im Raum, ob nicht ein palliativmedizinisch begleiteter Dialyseabbruch eine bessere Alternative wäre. Viele Nephrologinnen und Nephrologen tun sich damit schwer, weil es sich falsch anfühlt. Sie kennen ihre Dialyse-Patientinnen und -Patienten zum Teil über Jahrzehnte, haben ein starkes Vertrauensverhältnis aufgebaut, wollen den Kranken helfen und fühlen sich dem ärztlichen Ethos verpflichtet Leben zu erhalten, so die Erfahrung von Dr. Sebastian Pfrang, Oberarzt an der Klinik für Palliativmedizin im Franziskus-Krankenhaus Berlin. Für diese Situation sei ein Perspektivwechsel hilfreich: In der Palliativmedizin nicht das Sterben zu fokussieren, sondern die Gewissheit anzunehmen, dass die palliative Therapie – auch begleitend zu einer Dialysebehandlung − der Patientin oder dem Patienten noch angenehme Lebenszeit schenken kann. Die palliativmedizinische Begleitung endet zwar irgendwann mit dem Tod, beinhaltet aber keineswegs nur den Sterbeprozess. Dessen sollte man sich bei der schwierigen Entscheidung über einen Dialyseabbruch bewusst sein.
Im Interview reflektierte Dr. Pfrang, wie auf der Palliativstation im Franziskus-Krankenhaus mit dem Thema Dialyseabbruch umgegangen wird und wie die damit verbundenen ethischen Herausforderungen am besten bewältigt werden können.
Gibt es Daten in der Todesursachenstatistik von Dialysepatienten, die belegen, welchen Stellenwert der Dialyseabbruch in Deutschland hat?
Für Deutschland kenne ich solche Daten nicht. In den Vereinigten Staaten sammelt, analysiert und veröffentlicht das nationale Datensystem United Renal Data System Informationen zu chronischer Nierenerkrankung und Nierenversagen im Endstadium. Es besagt, dass in den USA der Dialyseabbruch 2021 in der Todesursachenstatistik auf Platz 2 nach Herzrhythmusstörungen lag. Auch eine mehrjährige Studie aus den Niederlanden hat entsprechende Daten sehr gut aufgearbeitet und zeigt: Zum Ende der Studie 2019 war der Dialyseabbruch die häufigste Todesursache bei Dialysepatienten. Und zwar zu ca. 60 % ausgelöst durch die Patienten selbst, und bei 40 % gab es medizinische Gründe. Über den Studienverlauf hinweg hat die Häufigkeit der Dialyse-Beendigung zugenommen. Ein Grund dafür könnte sein, dass in den Niederlanden das Thema selbstbestimmte Beendigung des Lebens einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland und daraus folgend auch die Akzeptanz der HD-Beendigung steigen könnte. Anzumerken ist jedoch, dass sich diese beiden Themen in der ethischen Bewertung grundlegend unterscheiden. Es gibt zwar auch hierzulande eine Gesetzeslage, aber das Thema ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen und es fehlen die Rahmenstrukturen.
Wurden in Bezug auf Dialyseabbruch Unterschiede zwischen HD und PD beobachtet?
Auch dafür kenne ich nur die Daten aus Amerika. Mit PD ist demnach der Dialyseabbruch ebenso wie bei HD die zweithäufigste Todesursache. HD selbst stellt jedoch einen größeren Risikofaktor als PD dar, die Dialyse zu beenden. Denn während die HD einen deutlicheren Einschnitt in das Alltagsleben bedeutet, ist die PD ein Verfahren, bei dem die Patienten unabhängiger sind. Die PD können sie mit guter Schulung zu Hause machen. Das ermöglicht in weiten Bereichen eine bessere Lebensqualität. Darüber hinaus unterscheidet sich auch das Patientenkollektiv von HD zu PD dahingehend, dass Patienten, die HD bekommen, oft gebrechlicher sind.
Gibt es weitere Risikogruppen für einen Dialyseabbruch, die Dialyseärztinnen und -ärzte besonders im Blick haben sollten? Wenn ja, welche Risikofaktoren stehen dahinter?
Grundsätzlich ist ein Dialyseabbruch in jeder Altersgruppe ein Thema, das man als Behandler im Kopf behalten sollte. Das höhere Lebensalter mit zunehmender Veränderung der Lebensumstände, Komorbiditäten, Alltagseinschränkungen etc. ist natürlich einer der Hauptrisikofaktoren. Zudem scheint das weibliche Geschlecht ein weiterer Faktor zu sein. Interessant ist, das hat auch die niederländische Studie gezeigt, dass die Dialyseabbruchrate abhängig davon ist, in welchem Zentrum die Patienten dialysieren. Das reflektiert ein bisschen welche Bedeutung es hat, wie die Behandler mit dem Thema umgehen.
Vermutlich verändert sich im Verlauf von Jahren und Jahrzehnten, die manche Patientinnen und Patienten dialysieren müssen, das Verhältnis zu Leben und Tod. Sie hatten in Ihrem Vortrag über verschiedene Krankheitsphasen gesprochen, in denen sich der Wunsch nach einem Dialyse-Abbruch entwickelt. Welche sind das und inwiefern ist es für den Behandler hilfreich zu differenzieren, in welcher Phase sich der oder die Betreffende befindet
Die in der Palliativmedizin verwendeten vier typischen Phasen in der letzten Lebenszeit nach Jonen-Thielemann orientieren sich an der Krankheitsschwere, der Symptomlast und den noch möglichen Alltagsaktivitäten. Je nachdem, in welcher Phase sich der Patient befindet, kann der Behandler entscheiden, welche Therapiemaßnahmen noch sinnvoll sind, welches realistische Therapieziel verfolgt werden kann, wie man mit dem Patienten umgeht. Das gilt auch, aber nicht nur für Dialysepatienten.
Menschen, die eine nicht kurable Erkrankung haben, können in der sogenannten Rehabilitationsphase mit guter medizinischer Begleitung ihren Alltagsaktivitäten nachgehen und noch ein gutes Leben führen. Sie kann Monate, sogar Jahre dauern. In der Begleitung liegt der Fokus hier auf Symptomkontrolle und Erhaltung der Selbstständigkeit. In der anschließenden über Wochen oder Monate dauernden Präterminalphase sind die Alltagsaktivitäten zunehmend eingeschränkt, die Symptomkontrolle rückt mehr in den Vordergrund. In der Terminalphase in den letzten Lebenswochen oder -Tagen nimmt die Krankheitslast zu, die Patienten werden bettlägerig, die Handlungsfähigkeit ist beeinträchtigt und die Betroffenen sind zunehmend auf Pflege angewiesen. In der Sterbephase, die sich auch über mehrere Tage erstrecken kann, ist das Bewusstsein des Sterbenden ganz auf seine Innenwelt gerichtet.
In jeder Situation, egal in welcher Phase sich der Patient befindet, kann der Wunsch auftreten zu sterben. Dabei sind Todeswünsche unheilbar kranker Menschen immer hochindividuell, weil jeder Mensch die Symptomlast, die er trägt, ganz persönlich bewertet. Das, was für den einen auszuhalten ist, ist für den anderen unerträglich. Zudem kann man bei von außen bewerteter guter Lebensqualität trotzdem ein für sich selbst unerträgliches Leben spüren. Um zu unterscheiden, in welchem mentalen Zustand sich der Patient in Bezug auf den Wunsch nach Lebensbeendigung befindet, kann man eine pragmatische Einteilung in Lebenssattheit, Lebensmüdigkeit und Suizidalität vornehmen.
Lebenssattheit kann man sich so vorstellen wie ein gutes Mahl am Lebensende, man ist gesättigt, man ist zufrieden, man hatte ein langes gutes Leben, und erlebt für sich jetzt vielleicht einen grauen Alltag. Man hat für sich das Gefühl, wenn das Leben jetzt zu Ende geht, dann ist das o.k. Das ist aber nichts, was mit einem akuten Sterbewunsch im klassischen Sinne verbunden ist. Dann gibt es das, was die Amerikaner „Wish to hasten death“ nennen, also den Wunsch, den Tod schneller herbei zu führen. Das entsteht vor allem aus medizinischen Notsituationen heraus und ist eher als ein Hilferuf zu werten, „ich möchte so nicht mehr weiter leben“. In dieser Situation können der Wunsch zu leben und das Bedürfnis zu sterben gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Und dann gibt es das, was viele mit Todeswünschen gleichsetzen, aber nicht immer dasselbe bedeutet, nämlich die Suizidalität mit evtl. tatsächlichem Handlungsdruck, das Leben beenden zu wollen. Darauf muss man differenziert reagieren.
Welche Ziele sollen in Gesprächen über Dialysebeendigung erreicht werden?
Wenn ein Patient den Wunsch nach Dialyseabbruch respektive einen Sterbewunsch äußert, dann muss man das in erster Linie als einen absoluten Vertrauensbeweis anerkennen, Akzeptanz für diese Äußerung aufbringen und mit dem Patienten in ein ergebnisoffenes Gespräch gehen. Ich muss herausfinden, wie ist die mentale Befindlichkeit des Menschen, der sterben will. Wenn ein Patient sagt, ich spring jetzt gleich aus dem Fenster, dann bedeutet das erst einmal überhaupt nicht, dass er es tut. Das Ziel ist zu zeigen, ich bin jetzt da, ich höre zu, ich verstehe, Sie haben Not, lassen Sie uns darüber reden.
Es gilt vor allem, das Vertrauen zum Patienten aufrecht zu erhalten. Letzten Endes sollte ich verstehen, warum der Patient es so möchte. Dazu gehört auch, im Einvernehmen mit dem Betroffenen, die Angehörigen mit einzubeziehen. Denn Angehörige müssen genauso verstehen, warum dieser Mensch die Dialyse jetzt beenden will. Wir haben dabei eine hohe Verantwortung für das Weiterleben der nach dem Tod Hinterbliebenen. Es ist vorweggenommene Trauerarbeit. Wenn die Angehörigen nachvollziehen können, warum der geliebte Partner, das Kind, oder wer auch immer, die Dialyse beendet hat, dann können sie das besser verstehen, in ihr Leben integrieren und damit weiterleben. Wenn das nicht verstanden wird, dann wird das im schlimmsten Falle immer als ein Suizid bewertet werden, der Sorgen, Fragen und Probleme hinterlässt.
Wenn ich mich als Angehöriger aber traue, es aus der Perspektive des Patienten zu sehen, der vielleicht seit vielen Jahren dialysiert, unter Begleit- oder schweren Folgeerkrankungen leidet, komplikative Shunts hat, die immer wieder operiert werden müssen, der immer wieder auf ITS landet, dreimal pro Woche zur Dialyse muss und bei dem die Eigenaktivitäten immer unmöglicher werden, dann kann man die Entscheidung vielleicht besser verstehen. Als Behandler können wir dann, gewissermaßen als Stellvertreter für den Patienten die Kommunikation moderieren.
Sich mit Themen wie Pflegebedürftigkeit, „langsames“ Sterben mit Beschwerden und dem „Sinn des Todes“ zu beschäftigen, fällt vielen Menschen schwer. Oft beeinflussen eigene Erfahrungen, bei fachlich Versierten medizinische Fachkenntnisse, in verschiedenen Kulturen unterschiedliche religiöse Aspekte und viele weitere Faktoren die Haltung zum Leben und zum Sterben. Warum ist es gerade für Nephrologinnen und Nephrologen wichtig, sich damit auseinander zu setzen?
Weil es bei Entscheidungen wie einem Dialyseabbruch um existenzielle Fragen geht. Da ist es hilfreich, wenn ich mir als Behandler grundlegend Gedanken darüber mache, wie stehe ich denn überhaupt zum Sterben, zu meinem eigenen Tod. Weil das auch bedeutet, wie ich mit meinem Gegenüber darüber sprechen kann. Wenn ich den Tod grundsätzlich ablehne und das Sterben als ein Versagen bewerte, werde ich nicht ergebnisoffen darüber reden können.
Ich finde, dass man sich als in der Medizin Tätiger grundsätzlich einmal mit seiner eigenen Endlichkeit beschäftigen, sich selbst nach seiner Spiritualität fragen sollte. Das sind Ressourcen, die mir selbst und auch dem Patienten helfen können. Wenn ich überhaupt nicht religiös gebunden bin, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich dann auf jemanden treffe, der stark spirituell ist, dann ist das so und das sollte ich akzeptieren. Man kann darüber ins Gespräch kommen. Es ist wichtig, Standpunkte zu haben, aber es ist nicht gut, aus diesen Standpunkten heraus zu verurteilen. Wenn ich den Patienten begleite und wir sind vielleicht im Dissens, sage ich, Sie müssen nicht das machen, was ich Ihnen vorschlage, aber ich erwarte, dass wir einander zuhören. Alle, die wir hier sind, können nur versuchen, in bestem Wissen und Gewissen dem Patienten Vorschläge zu machen, wie das weitere therapeutische und Versorgungsprozedere aussieht, und wenn er das nicht will, dann ist das seine Entscheidung.
Genau so ist es auch mit der Spiritualität. Meine Erfahrung sagt, die Spiritualität ist eine oft unterschätzte Ressource des Patienten. Wenn ich einen hochspirituellen Menschen habe, der daraus eine große Lebenskraft und große Freude und Sicherheit zieht, dann ist es auch meine Aufgabe, den Menschen mit diesem Wissen zu begleiten. Man kann darüber reden, auch wenn man selbst eine völlig andere spirituelle Vorstellung hat.
Welches ist aus Ihrer Erfahrung für Ärzte die größte ethische Herausforderung bei der Entscheidung die Dialyse abzubrechen?
Ich denke, das ist der Perspektivwechsel beim Blick auf Leben und Sterben. Einer der größten Unterschiede der Palliativmedizin im Vergleich zu allen anderen Fachbereichen, die kurativ intendiert arbeiten, ist, dass wir den Tod oder das Sterben als einen natürlichen Verlauf des Lebens betrachten können. Wir arbeiten aktiv daran diesen Prozess zu begleiten, ohne das Ziel einer Heilung oder den Lebenserhalt um jeden Preis.
Die Beendigung der Dialysebehandlung kann fälschlicherweise als ein Akt der aktiven Herbeiführung des Todes gewertet werden. Das macht es auch so belastend, einen Abbruch einzuleiten. Ich denke aber, man müsste die Perspektive dahingehend wechseln, dass man durch die Beendigung der Dialyse den natürlichen Verlauf des Lebens wieder zulässt. Es geht dann darum, im Konsens mit dem Patienten das Vertrauen darauf zu entwickeln, dass dieser Verlauf nun so gut wie möglich begleitet wird und vor allem gelebt werden kann.
Worüber wir uns dabei Gedanken machen müssen ist: Eines der schärfsten Schwerter, das wir als Ärzte haben, ist die Indikation. Es gibt aber immer wieder Situationen, in denen man sich vielleicht in der Indikation uneinig ist. Und deswegen muss man für sich reflektieren, worauf fußt die Indikation. Die Basis der Indikation ist das Therapieziel, das vom Behandler gemeinsam mit dem Patienten festgelegt wird. Ist das Therapieziel ausschließlich der Lebenserhalt, dann ist der Dialyseabbruch natürlich nicht sinnvoll. Aber wenn das Therapieziel ist, Ruhe zu finden, ein gutes Lebensende zu erreichen, gut behütet begleitet sterben zu können, dann ist die Indikation für die Dialyse zumindest in Frage zu stellen.
Dabei darf die Palliativmedizin aber keinesfalls unter den Verdacht kommen, dass wir immer die HD beendigen wollen. Vielmehr geht es darum, eine hochindividualisierte Medizin für den einzelnen Patienten zu ermöglichen. Es klingt vielleicht für Außenstehende absurd, aber bei uns geht es um das Leben, nicht primär um das Sterben. Natürlich wissen wir, worauf es hinausläuft. Und viele Patienten versterben hier auch oder im Hospiz. Aber am Ende ist das Ziel, bis dahin ein erträgliches gutes Leben zu führen. Die Patientinnen und Patienten sollen jeden Tag für sich so leben können, wie es für sie richtig ist − mit Freunden, Zugehörigen, mit der Familie; sich auf ein gutes Essen freuen, mal ein Eis genießen, die Lieblingsmusik hören, vielleicht mal eine Zigarette rauchen oder Silvester mit einem Glas Whisky auf der Dachterrasse verbringen, so wie bei uns schon geschehen.
Und wenn wir uns für eine Beendigung der Dialysetherapie entscheiden, dann wird der Patient auch weiterhin so behandelt, dass sein Leben in diesem Zeitraum so gut ist, wie es geht. Es können alle Tag und Nacht da sein, die für ihn wichtig sind, er bekommt die gleiche Pflege, wird weiterhin von den Ärzten visitiert, wir kümmern uns um die Symptome. Das wird nicht nur durch eine rein medikamentöse Behandlung ermöglicht, sondern durch das besondere Therapiekonzept, das in der Palliativmedizin gelebt wird, höchst interprofessionell. Wir betreuen hier mit Ausnahme der Pädiatrie Patienten aus allen Bereichen der Medizin. So nehmen wir auch Patienten nach bereits initiiertem Dialyseabbruch auf, um die Dialyse-Beendigung medizinisch zu begleiten. Aber wir betreuen hier auch Patienten, die noch dialysiert werden. Es ist keine Voraussetzung, die Dialyse zu beenden, um auf die Palliativstation zu gehen. Wir haben auch immer wieder Patienten, die dialysepflichtig und zur Symptomkontrolle bzw. zur Perspektivplanung zu uns kommen.
Wie geht es dann weiter?
Wenn ein Patient zur Dialysebeendigung zu uns kommt, besprechen wir uns zunächst mit dem Zuweiser. Wir sprechen über den Grund der Verlegung und die medizinische Situation. Die Begleitung durch den Nephrologen, wie alle anderen Fachbereiche ist dann sehr offen organisiert. Wenn wir die Expertise von anderen Fachrichtungen brauchen, können wir immer auf kurzem Wege hier im Haus mit den Kollegen zusammenarbeiten, sind aber auch in ganz Berlin gut vernetzt. Alle Fachgruppen, die hier arbeiten, Ärzte, Mitarbeitende in der Pflege, der Psychologie, Seelsorge, Physiotherapie, Sozialarbeit etc., sind nahezu gleichberechtigt. Der Patient kann wählen, mit wem er gut kann, mit wem vielleicht nicht so gut. Wir versuchen, den Patienten immer auf Augenhöhe zu begegnen, bei aller Hochleistungsmedizin die Menschlichkeit absolut in den Vordergrund zu rücken, ihm so viel Autonomie wie möglich zu geben, ihn als Person wahrzunehmen und nicht als Erkrankungsfall. All das sind Maßnahmen, die die Symptomlast reduzieren und helfen, würdevoll und in Ruhe zu sterben.
Wie sollten sich Ärztinnen und Ärzten vorbereiten, um mit aussichtslosen medizinischen Situationen und Todeswünschen ihrer Patientinnen und Patienten ethisch gewissenhaft umzugehen?
Das Wichtigste ist die über viele Jahre aufgebaute Vertrauensbasis zwischen Nephrologen und Dialysepatienten zu nutzen und auszubauen. In einem vertrauensvollen Gesprächsrahmen sollte der Patient ohne Angst sagen dürfen, „ich möchte die Dialyse beenden“. Sie oder er sollte wissen, egal, wie ich mich entscheide, mein Arzt ist immer für mich da. Und wenn ich die Dialyse beende, dann wird er mich vielleicht nicht mehr weiter betreuen können, aber er kümmert sich darum, dass es jemand macht, der das gut kann.
Es gibt dabei eine ganz große Sorge aller Patienten. Wenn wir Perspektivgespräche führen und auf Patientenverfügungen zu sprechen kommen − sollen Maschinen angeschlossen, soll eine Beatmung initiiert, soll reanimiert werden o. ä. − dann befürchten viele, „wenn ich sage, ich möchte das nicht, dann wird gar nichts mehr getan.“ Aber der Patient soll wissen, er kann alles ansprechen, und trotzdem bleibe ich als Behandler bei ihm. Und auch wenn eine Domäne der Nephrologie die Dialyse ist, kann ich als Nephrologe den Patienten auch ohne Dialyse, vielleicht mit einem anderen Behandlungskonzept weiter begleiten. Das führt häufig dazu, dass die Patienten sagen, ich dialysiere weiter, weil ich weiß, wo ich dann gut aufgehoben bin, wenn es wirklich nicht mehr geht. Wichtig ist, den Patienten zu vermitteln, wir machen alles so wie bisher, aber wenn Sie nicht mehr können, dann reden wir darüber. Und wir nehmen uns Zeit alle Dinge im Vorfeld zu besprechen, dass jeder Beteiligte weiß, wie man sich zu verhalten hat, wenn eine Notfallsituation eintritt. Man sollte nicht zu Ad hoc-Entscheidungen gezwungen sein. Obwohl im klinischen Alltag sicher schwer umzusetzen, sollte im besten Falle mit dem Patienten vielleicht schon einmal über den Dialyseabbruch gesprochen werden, wie es formal abläuft und wie es weitergeht. In solch schwierigen Situationen, wie sie kurz vor dem Lebensende auftreten können, geht es immer um Offenheit, Vertrauen und Letztverlässlichkeit.
Herrn Dr. Pfrang, vielen Dank für dieses Gespräch.
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).