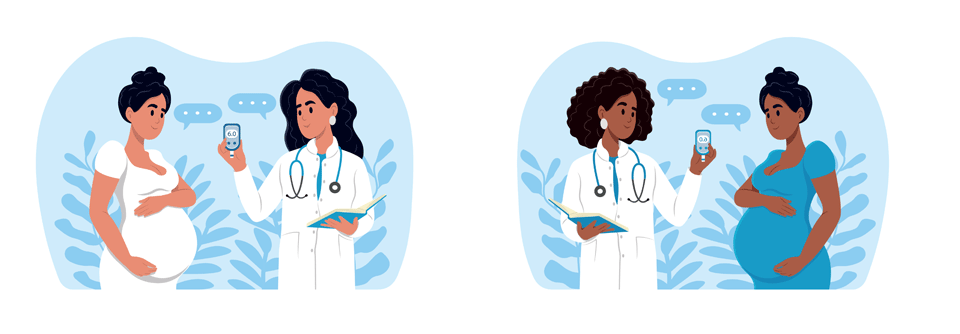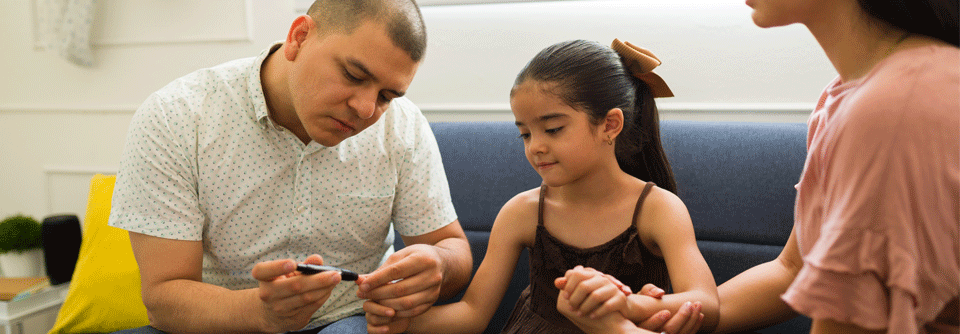Die Frauen- und Familiengesundheit zu verbessern, ist ein starker Antrieb
 Diabetes in der Schwangerschaft ist ein vielschichtiges Thema.
© Анна Брусницына - stock.adobe.com
Diabetes in der Schwangerschaft ist ein vielschichtiges Thema.
© Анна Брусницына - stock.adobe.com
Interessantes über Metformin, Inkretinmimetika und die rechtzeitige Vorstellung in der Geburtsklinik? Gibt‘s in der begleitenden Podcast-Folge.
Wie viele Frauen haben in der Schwangerschaft Diabetes?
Prof. Groten: Wir haben ganz gute Zahlen aus der Perinatalstatistik bzw. der Bundesauswertung für Geburtshilfe des IQTIG. Die Zahlen von 2023 zeigen, dass 7,4 % der Frauen, die schwanger waren, einen Gestationsdiabetes hatten. Die Zahlen sind seit 2012 ansteigend, was sicherlich daran liegt, dass das allgemeine Screening eingeführt wurde, aber auch daran, dass die Frauen zunehmend übergewichtig und adipös sind, was ein wesentlicher Risikofaktor ist für Gestationsdiabetes. Und 1,1 % der Frauen haben Typ-1- und Typ-2-Diabetes. Welcher Diabetestyp es ist, wird nicht genau aufgeschlüsselt, aber man schätzt, 20 bis 30 % haben Typ-2-Diabetes und die Übrigen Typ-1-Diabetes. Bei diesen präkonzeptionell bekannten Diabetesformen ist die Prävalenz stabil.
Was sind die negativen Folgen eines Gestationsdiabetes (GDM)?
Prof. Groten: Ganz wichtig ist: Letztendlich ist für Mutter und Kind in der Schwangerschaft nicht die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes schädlich oder nachteilig, sondern die Hyperglykämie. Deshalb bemühen wir uns so darum, die Hyperglykämie bei den Müttern zu vermeiden und damit auch alle Folgen, die ein Zuviel an Zucker im Blut haben kann. Wir wissen aus Zeiten, in denen noch nicht gescreent, die Behandlung des GDM noch nicht so ernst genommen wurde, dass Mütter mit GDM häufiger Hochdruckerkrankungen und Infekte der Blase und auch des Genitaltraktes bekamen. Oft bleibt es nicht bei einer Blasenentzündung, sondern es kommt zu einer Frühgeburtlichkeit. Das sehen wir kaum noch, wenn wir den GDM gut behandeln.
Für die Kinder sind gute Werte noch viel relevanter, weil der hohe Zucker der Mutter eins zu eins zum Kind übergeht und die Kinder im Gegensatz zur Mutter ausreichend Insulin produzieren können. Die Kinder bauen den Zucker ein, werden dadurch dick und groß, mit allen Folgen, die das im Geburtsvorgang auch für die Mutter haben kann. Wir wissen, dass dieses Zuviel an Insulin im Blut der Kinder die Organreife hemmt. Außerdem wird durch die ständige Überstimulation in der Schwangerschaft der ganze Stoffwechsel dieser heranwachsenden Menschen lebenslang so programmiert, dass sie später ein hohes Risiko haben, dick zu werden und selbst einen Diabetes zu entwickeln. Das nennen wir fetale Programmierung. Die gute Nachricht ist: Wenn wir beim Schwangerschaftsdiabetes den Zucker gut einstellen, können wir all das vermeiden, und zwar zu einem sehr hohen Prozentsatz.
Auf einen GDM gescreent wird zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche (SSW). Was spricht für ein früheres Screening?
PD Dr. Laubner: 2023 wurde eine Studie dazu durchgeführt und im New England Journal publiziert. Die teilnehmenden Frauen hatten Risikofaktoren für einen GDM und sind im Mittel um die 16. SSW gescreent worden, also deutlich früher als normalerweise. Frauen, die schon früh in der Schwangerschaft einen auffälligen Test hatten und dann auch behandelt wurden, haben profitiert, was das Outcome der Kinder betrifft. Die Frage ist allerdings: Welche Grenzwerte sind sinnvoll? Denn man hat in dieser Studie gesehen: Frauen mit sehr hohen Werten haben wesentlich stärker profitiert, auch was das kindliche Outcome betrifft. Aber im Prinzip ist es schon sinnvoll, Frauen, die Risikofaktoren haben, deutlich früher zu testen.
Prof. Groten: Wir wissen, dass der Insulinbedarf besonders ab der 20., 22. SSW ansteigt. Bei ganz gesunden Frauen würden wir durch ein früheres Screening eine Störung so früh gar nicht erkennen können. Bei diesen Frauen ist es wichtig, dass wir dann testen, wenn der Bedarf an Insulin stark ansteigt.
Was geben Sie den Frauen mit GDM mit auf den Weg?
PD Dr. Laubner: Wir geben Empfehlungen für Ernährung und körperliche Aktivität. Weil die Frauen häufig übergewichtig oder adipös sind, müssen sie darauf achten, die Gewichtszunahme im Rahmen zu halten. Da gibt es ganz klare Vorgaben: Frauen mit einem BMI über 30 sollten möglichst nur fünf bis neun Kilogramm in der Schwangerschaft zunehmen. Die Behandlung des GDM durch Lebensstilmodifikation gelingt meistens, bei 20 bis 30 % der Frauen ist aber doch eine Insulintherapie notwendig.
Prof. Groten: Man muss den Frauen klarmachen, dass es in der Schwangerschaft einen erhöhten Insulinbedarf gibt. Ist nicht genug Insulin da, muss man es genauso substituieren wie Eisen oder Folsäure.
Es wird diskutiert, ob schwangere Frauen mit Typ-2- oder Gestationsdiabetes von einem CGM-System profitieren. Wie sehen Sie das?
Prof. Groten: Ich bin der Auffassung, wenn wir Frauen in dieser Situation vom blutigen Messen entlasten, ist das ein riesiger Vorteil. Am Kompetenzzentrum für Diabetes und Schwangerschaft in Jena haben wir seit fünf Jahren den Frauen relativ regelmäßig und zunehmend Sensoren verschrieben und wir wissen, dass sie mit der Behandlung viel, viel zufriedener sind.
Außerdem lernen die Frauen durch das Biofeedback viel schneller, wie sie ihren Blutzucker auch anders regulieren können als mit Insulin. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Frauen auch längerfristig gesünder leben werden. Dieser Lerneffekt ist mehrfach nachgewiesen worden und wir erwarten jetzt die ersten Studien-
ergebnisse, die zeigen, dass tatsächlich das Outcome besser ist. Aus meiner Sicht sind wir ethisch dazu verpflichtet, den Frauen einen Sensor zu geben.
Warum sollten Frauen, die einen GDM hatten, nach der Geburt an einem Screening teilnehmen?
PD Dr. Laubner: Man kann den Gestationsdiabetes auch als Prä-Typ-2-Diabetes bezeichnen. Das Risiko für einen Diabetes mellitus Typ 2 ist innerhalb der ersten zehn Jahre siebenfach erhöht. Das Screening ist sinnvoll, um präventiv einzugreifen oder rechtzeitig eine Therapie in die Wege zu leiten. Es ist erschreckend, wie wenige Frauen zum Screening gehen – nämlich nur 40 %.
Wann sollten die Frauen zum Screening gehen?
PD Dr. Laubner: Das erste Mal sechs bis zwölf Wochen nach der Geburt, so sagt es die aktuelle Leitlinie, und zwar mittels eines 75-Gramm-oGTT. Das ist wahrscheinlich für die Frauen und die betreuenden Praxen nicht sehr praktikabel, sodass man schauen muss, ob sich das Risiko mit klinischen Prädiktoren besser abschätzen lässt, damit man eine individuelle Nachsorge machen kann. In der neuen Leitlinie wird sich da ein bisschen was ändern. Danach folgt ein jährliches oder zweijährliches Screening. Und wenn die Frauen das erste Screening nicht wahrnehmen, aber innerhalb des ersten Jahres kommen, ist das trotzdem gut.
Prof. Groten: Damit mehr Frauen zum Screening gehen, haben wir von der AG mit der GestDiab-Studiengruppe einen Nachsorgepass entwickelt. Wir hoffen, so mehr Frauen dazu zu bringen, sich auch um sich selbst zu kümmern.
Welche Projekte verfolgt die AG Diabetes & Schwangerschaft?
Prof. Groten: Etabliert hat sich der jährliche Workshop, in dem wir die aktuellen Themen nicht auf Fortbildungs-, sondern auf Diskussionsebene besprechen. Der Workshop ist ganz zentral und macht die AG hoffentlich auch attraktiv.
PD Dr. Laubner: Wir beteiligen uns natürlich intensiv an den Leitlinien und arbeiten an Zertifizierungsmodulen wie dem Modul Diabetes & Schwangerschaft mit. Wir werden zukünftig zudem versuchen, uns mit anderen AGs zu vernetzen.
Warum engagieren Sie sich als Sprecherinnen der AG?
Prof. Groten: Das Thema liegt uns sehr am Herzen. Es ist ein Bereich, in dem fast völlige Prävention möglich ist, und man kann ganz viel für die Frauen- und Familiengesundheit erreichen. Gerade die Entdeckung der Schwangeren, die in der Schwangerschaft ein Problem haben, als Zielgruppe für Präventionsmaßnahmen ist etwas, was wir politisch nach außen tragen müssen und wollen, weil es ein Aspekt der ungenügend beachteten Frauengesundheit ist.
PD Dr. Laubner: Für mich ist der präventive Aspekt auch sehr wichtig. Man kann die Frauen motivieren, den Gestationsdiabetes zu nutzen, um dem Kind etwas Gutes zu tun und den Typ-2-Diabetes zu verhindern. Und natürlich braucht es auch einfach Menschen, die sich in einer Fachgesellschaft engagieren.
Quelle: Interview: Nicole Finkenauer
Mehr zum O-Ton Diabetologie
Den Podcast O-Ton Diabetologie gibt es alle 14 Tage mittwochs auf den gängigen Podcast-Plattformen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Diabetologie über neue Diabetestechnologien und Behandlungsformen, aktuelle Forschungsergebnisse und Leitlinienupdates, Reizthemen der Gesundheitspolitik und der Digitalisierung.
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).