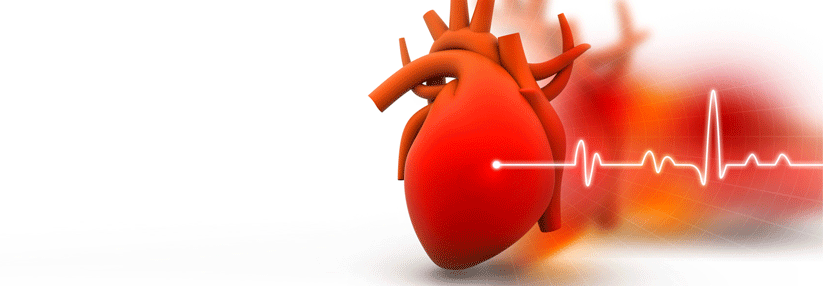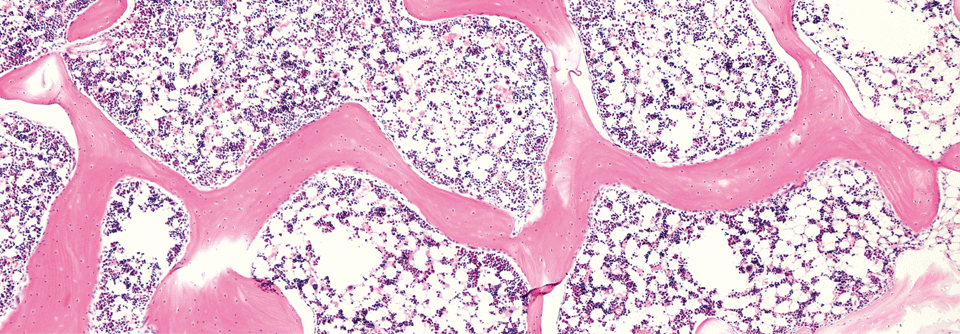Ein Update zu Takotsubo und SCAD
 Nichtobstruktive Erkrankungen bringen das Herz ebenfalls in akute Lebensgefahr.
© iDoPixBox - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Nichtobstruktive Erkrankungen bringen das Herz ebenfalls in akute Lebensgefahr.
© iDoPixBox - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Man sagte ihnen eine Benignität nach oder hielt sie aufgrund ihrer Prävalenz für weniger relevant: Nichtobstruktive kardiale Erkrankungen wurden als Ursache von Ischämien und thorakalen Schmerzen lange unterschätzt. Dabei beeinflussen z. B. das Takotsubo-Syndrom und die spontane Koronardissektion die Langzeitprognose deutlich.
Takotsubo-Syndrom
Es betrifft ältere Frauen, vor allem in Asien, und wird durch emotionalen Stress ausgelöst– das waren jahrelang die Attribute des Takotsubo-Syndroms. Doch inzwischen weiß man, dass sich dahiner eine global vorkommende, ernst zu nehmende Erkrankung verbirgt, erklärte PD Dr. Jelena Ghadri von der Klinik für Kardiologie am Universitätsspital Zürich. Statt einer psychisch bedingten benigen Störung handelt es sich um eine mikrovaskuläre Form des akuten Koronarsyndroms, die auch Männer betreffen kann und und vor keiner Ethnie haltmacht. Zwar gehören seelische Belastungen weiterhin zu typischen Triggern, aber genauso sind körperliche Anstrengungen oder positive Erlebnisse mögliche Auslöser. Und manchmal findet sich kein fassbarer Grund.
Das Takotsubo-Syndrom kann mit oder ohne ST-Hebung einhergehen, an Biomarkern sind oft BNP und Troponin erhöht, die Koronarien stellen sich meist unauffällig dar. Die Prognose ist nicht so günstig wie lange gedacht, betonte die Kollegin. In einer eigenen Studie ermittelte ihr Team, dass alle untersuchten Patientinnen und Patienten einen erhöhten mikrozirkulatorischen Widerstand in den drei großen Koronararterien hatten. Ein hoher mikrozirkulatorischer Widerstandsindex war mit einem größeren Risiko für schwere Komplikationen wie kardiogener Schock, Tod oder Arrhythmien assoziiert. In einer anderen Arbeit hat sich eine frühe QT-Zeit-Verlängerung als wichtiger prognostischer Marker entpuppt: Ein Intervall über 460 ms erhöhte die Gefahr für Tod jeglicher Ursache oder Arrhythmien.
Für die Risikostratifizierung und Abgrenzung des Takotsubo-Syndroms vom Myokardinfarkt scheint KI hilfreich zu sein, wie einige Studien in den letzten Jahren zeigten. Allerdings waren es überwiegend Beobachtungsstudien mit kleinen Fallzahlen. Weitere Untersuchungen laufen noch.
Das Team um Dr. Ghadri hat vor wenigen Jahren auch das Rezidivrisiko quantifiziert. Von ungefähr 1.400 Patientinnen und Patienten erlebten im mittleren Follow-up von 2,5 Jahren 4,7 % ein erneutes Ereignis, ein Drittel davon mit abweichender Morphologie, fast die Hälfte durch andere Trigger. Als starke Prädiktoren für ein Rezidiv fanden sich neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Eine aktuellere Single-Center-Studie aus dem letzten Jahr brachte ähnliche Ergebnisse. Laut der Expertin unterstreicht das die Bedeutung der Hirn-Herz-Interaktion.
Zu thromboembolischen Komplikationen gibt es nur wenig Daten. Ebenfalls im eigenen Patientengut konnten Dr. Ghadri und ihr Team eine Inzidenz von 3,3 % ermitteln, meistens ereigneten sich die Komplikationen innerhalb der ersten Woche. Die apikale Manifestation des Syndroms, eine Ejektionsfraktion unter 35 %, eine hohe Leukozytenzahl sowie vorbestehende Gefäßerkrankungen erwiesen sich als Risikofaktoren. Zusammenfassend hielt Dr. Ghadri fest, dass das Takotsubo-Syndrom bei Weitem kein Mysterium mehr ist und „unsere volle wissenschaftliche und klinische Aufmerksamkeit verlangt“.
AMIS und NAMIS: dem Kind den richtigen Namen geben
Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Änderung der Nomenklatur von ischämischen Syndromen hielt Prof. Dr. Juan Carlos Kaski von der St. George‘s University of London. AMIS und NAMIS sollen sie nun heißen: Acute Myocardial Ischemic Syndrome und Non-Acute Myocardial Ischemic Syndrome. Die vielen bisherigen uneinheitlichen Namen wie stabile KHK, stabile ischämische Herzkrankheit, chronisches Koronarsyndrom oder chronische Koronarkrankheit hätten viel Verwirrung gestiftet. Handelt es sich um eine Krankheit oder ein Syndrom? Spielt sich alles in den epikardialen Koronarien ab? Und muss man wirklich so streng zwischen obstruktiven und nichtobstruktiven Ursachen unterscheiden?
Die stenosezentrierte Betrachtung der Problematik vereinfache die Sache zu sehr und die Begriffe chronisch bzw. stabil suggerierten ein gewisses Maß an Erholung, so der Kollege. „Akut“ bzw. „nichtakut“ scheine angemessener. Außerdem müsse man den Fokus weg von den Koronarien hin zum Zielobjekt der Ischämie verlagern, dem Myokard. Und mit dem Wort „Syndrom“ ließe sich die Komplexizität der Pathomechanismen besser erkennen. Das Ganze ergebe aber nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht Sinn, betonte Prof. Kaski. In der Praxis erinnere es auch Ärztinnen und Ärzte daran, diejenigen zu identifizieren, die trotz fehlender Obstruktion ein hohes Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse haben.
Spontane Koronararteriendissektion
Eine spontane Koronararteriendissektion (Spontaneous Coronary Artery Dissection, SCAD) tritt überwiegend bei Frauen im mittleren Alter auf. Bis zu 90 % aller Betroffenen sind weiblich, kardiovaskuläre Risikofaktoren liegen kaum vor. Bei Frauen unter 60 Jahren zeichnet sie für 22–35 % aller akuten Koronarsyndrome verantwortlich, insgesamt für 2–4 %. Vermutlich wird die Prävalenz aber weltweit unterschätzt, so Prof. Dr. Kurt Huber, Sigmund Freud Privatuniversität, Wien.
Prädisponierende Faktoren umfassen u. a. Schwangerschaften (vor allem mehrfache), fibromuskuläre Dysplasie, Kollagenosen, genetische und hormonelle Einflüsse sowie seelischen Stress. Ätiologisch liegt der SCAD eine Abspaltung von Intima und Media zugrunde, die weder atherosklerotisch noch iatrogen bedingt ist. In der Folge bildet sich ein Hämatom in der Gefäßwand, erklärte Prof. Huber. Angiografisch unterscheidet man im Wesentlichen drei Typen:
- Typ 1 mit mehreren strahlendurchlässigen Füllungsdefekten und Intimalappen (25 %)
- Typ 2 mit langstreckiger diffuser Gefäßverengung (70 %)
- Typ 3 mit fokaler oder tubulärer Stenose, die eine Atherosklerose imitiert (5 %)
Es gibt noch einen Typ 4 mit völligem Gefäßverschluss, der häufig als Thrombose fehlgedeutet wird.
Die Behandlung erfolgt bevorzugt konservativ
Beim Verdacht auf eine SCAD sollte frühzeitig eine Koronarangiografie durchgeführt werden. Die Therapie erfolgt vorzugsweise konservativ mit Betablockern und einfacher Plättchenhemmung. Eine etwaige Hormonbehandung stoppt man am besten. Die Revaskularisieriung wird u. a. bei persistierender Angina, anhaltender ST-Hebung, hämodynamischer oder elektrischer Instabilität sowie multiplen oder proximalen Dissektionen empfohlen.
Das Rezidivrisiko liegt nach spontaner Koronardissektion bei 3–4%, das für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) bei 8–9 %. Besonders gefährdet für beides sind Patientinnen und Patienten mit einem Schlaganfall in der Anamnese oder fibromuskulärer Dysplasie. Das Risiko für MACE steigt auch unter oraler Antikoagulation und dualer Plättchenhemmung. Es gibt weniger Rezidive, wenn Betablocker konsequent zum Einsatz kommen und eine Hypertonie optimal behandelt wird, unterstrich Prof. Huber. Menschen, die im Rahmen ihrer SCAD einen Herzstillstand erleiden und überleben, haben später ein deutlich höheres Risiko für Herzinfarkte, Rezidive, einen kardiogenen Schock oder eine Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion.
Quelle: Kongressbericht ESC* Congress 2025
* European Society of Cardiology
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).