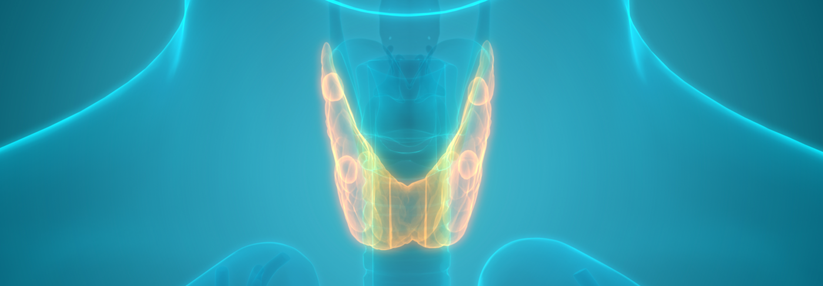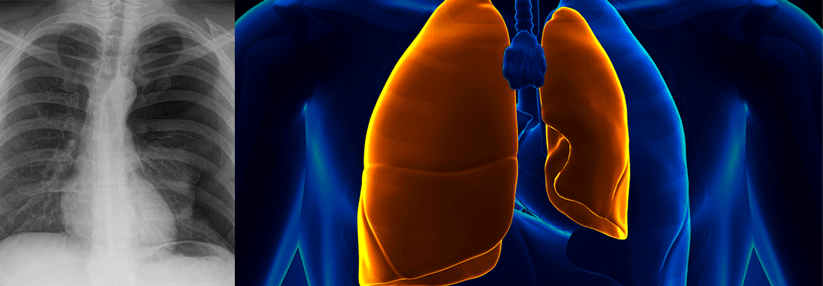Erste S3-Leitlinie bestätigt klassische Behandlungsansätze
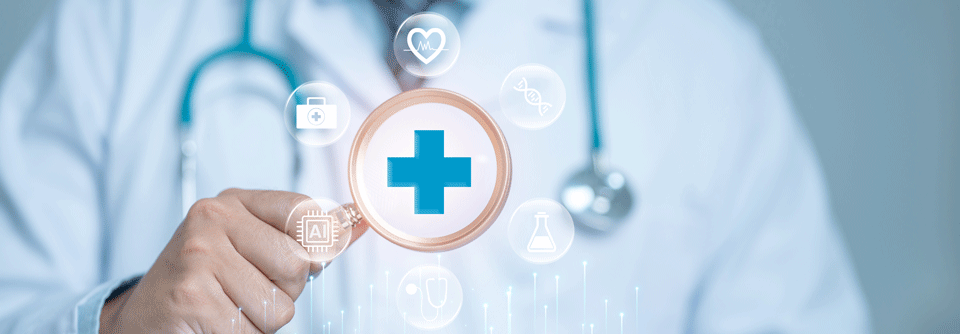 Eine neue S3-Leitlinie soll die Diagnose und Therapie von Schilddrüsenkarzinomen verbessern.
© Antony Weerut – stock.adobe.com
Eine neue S3-Leitlinie soll die Diagnose und Therapie von Schilddrüsenkarzinomen verbessern.
© Antony Weerut – stock.adobe.com
Abklärung verdächtiger Knoten
Vor einer Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse und des Halses sollte zunächst eine klinische Evaluation erfolgen (Expert:innenkonsens; EK). Zur Risikostratifizierung entdeckter Schilddrüsenknoten empfehlen die Fachleute eine standardisierte B-Mode-Sonografie („Soll“-Empfehlung, EK), sofern verfügbar zusammen mit einer Elastografie („sollte“; Empfehlungsgrad B; Evidenzlevel 2a). Die Malignitätswahrscheinlichkeit sollten Ärzt:innen mittels eines TIRADS-Klassifikationssystems einschätzen (B; 2a).
Als Teil jeder Knotenabklärung ist zudem eine TSH-Bestimmung angeraten, nicht jedoch eine routinemäßige Ermittlung der Thyreoglobulin-Konzentration (Tg; „soll“; EK). Bei Erwachsenen soll im Rahmen der Dignitätsbestimmung von Befunden ≥ 1 cm unabhängig vom TSH-Wert eine Schilddrüsenszintigrafie erfolgen (EK). Beim szintigrafischen Befund eines hyperfunktionellen (autonomen) Knotens soll keine weitere, über die Sonografie hinausgehende Abklärung stattfinden. Ebenso stellt ein szintigrafisch nachgewiesener hypofunktioneller Herd keine alleinige Operationsindikation dar (beides EK).
Finden sich Anzeichen von Malignität, soll zusätzlich eine systematische sonografische Untersuchung der zugehörigen Lymphabflussgebiete nach standardisiertem Protokoll erfolgen (EK). Zur Beurteilung der zervikalen Lymphknoten empfiehlt das Leitlinienteam die farbkodierte Dopplersonografie („sollte“; EK).
Die Fachleute raten von einer unselektierten Punktion von Schilddrüsenknoten ab (EK). Eine Feinnadelpunktion von Knoten ≥ 1 cm soll ausschließlich nach sorgfältiger Vorselektion erfolgen und sofern sich das Ergebnis auf die Planung des weiteren Vorgehens auswirkt (EK). Eine Gegenindikation besteht bei Verdacht auf ein C-Zell-Karzinom, beispielsweise wegen suspekter Calcitoninwerte („sollte nicht“; EK). Auch auffällige Lymphknoten sollten nur punktiert werden, falls sich klinische Konsequenzen ergeben (EK).
Chirurgisches Vorgehen
Die Operation bleibt wichtig, es erfordern jedoch nicht alle Fälle eine komplette Thyreoidektomie. So kann ein isoliertes unifokales papilläres Mikrokarzinom (PTMC) ohne aggressive zytologische Merkmale oder sonstige Risikofaktoren bei Personen über 30 Jahren zunächst beobachtet werden, wenn sich diese nach sorgfältiger Aufklärung dafür entscheiden. Auch genügt für PTMC (< 10 mm) ohne weitere Risikofaktoren eine Hemithyreoidektomie („sollte“, EK). Die Schilddrüse sollte jedoch in folgenden Fällen ganz entfernt werden:
- multifokale PTMC
- histologisch risikoreicher Subtyp
- familiäre Häufung
- Lymphknotenmetastasen
- vorausgegangene zervikale Bestrahlung
Liegt ein größerer papillärer Tumor vor (PTC; ab 1 cm), bildet die totale Thyreoidektomie den Regelfall (B; 2b). In begründeten Fällen kann im Stadium pT1b/pT2 die Hemithyreoidektomie eine Therapiestrategie darstellen, insofern keine Risikofaktoren wie Angioinvasion, Lymphknotenmetastasen, Kapselinfiltration, familiäre Prädisposition oder vorausgegangene Bestrahlung vorliegen (0; 2b).
Im Fall von cN1-PTC sollten Chirurg:innen eine zentrale Kompartmentresektion durchführen. Liegen ein cN0-Status und ein Durchmesser > 1 cm vor, sollte sie nur begründet und mit entsprechender chirurgischer Expertise erfolgen (B; 1a). Eine primäre laterale Kompartmentresektion empfiehlt das Leitlinienteam wiederum bei einer Lokalisation des PTC-Primärtumors im oberen Schilddrüsenpol oder augedehntem zentralem Lymphknotenbefall sowie bei klinischem Verdacht/Nachweis von lateralen Lymphknotenmetastasen, nicht jedoch routinemäßig prophylaktisch (EK).
Für follikuläre Schilddrüsentumoren (FTC) richten sich die Empfehlungen nach der Invasivität. Solitäre minimalinvasive FTC bis 4 cm ohne Angioinvasion sollten primär mit einer Hemithyreoidektomie behandelt werden, auf eine prophylaktische Lymphknotendissektion sollten Ärzt:innen verzichten (EK). Zur vollständigen Entfernung der Schilddrüse raten die Fachleute bei histopathologisch nachgewiesener Angioinvasion und/oder einer Größe ≥ 4 cm sowie breit-invasiv wachsenden Tumoren (EK).
Bei onkozytären Karzinomen ist unabhängig von der Größe des Primärtumors eine totale Thyreoidektomie geboten („sollte“; EK). Liegt ein resektables, schlecht differenziertes papilläres Karzinom vor, soll auch dann eine vollständige Resektion inklusive systematischer Kompartmentresektion durchgeführt werden, wenn Fernmetastasen existieren (EK).
Vor allem für Kinder und Jugendliche empfehlen die Verfasser:innen eine Behandlung an spezialisierten Zentren (EK). Aber auch im Erwachsenenalter betonen sie, dass Fachleute mit Erfahrung in der Schilddrüsenchirurgie den Eingriff vornehmen sollten (B; 2a).
Radiojodtherapie
Die Entscheidung über eine Radiojodtherapie soll interdisziplinär in einem Tumorboard getroffen werden (EK). Die Autor:innen geben Empfehlungen, wann dieses Vorgehen infrage kommt. Nach der Thyreoidektomie, aber vor Beginn einer Radiojodtherapie sollen Ärzt:innen TSH sowie Thyreoglobulin und assoziierte Antikörper (TAK) bestimmen (EK).
Im Anschluss folgen für zunächst ein bis zwei Jahre Kontrollen im Abstand von drei bis sechs Monaten. Dazu gehören Ultraschall und eine Bestimmung von Tg (hochsensitiv), TAK und schilddrüsenspezifischen Hormonen (EK). Bei TAK-Positivität und/oder mindestens mittlerem Rezidivrisiko soll nach 6–12 Monaten eine ¹³¹I-Ganzkörper-Szintigrafie durchgeführt werden (A, 2a). Kolleg:innen sollten andererseits auf letztgenannte Untersuchung verzichten, falls bereits initial ein exzellentes Therapieergebnis vorliegt und sich die Tg-Konzentration nicht nachweisen lässt oder auf niedrigem Niveau weiter fällt (B; 2a).
| Subtyp | Stadium | Anmerkungen | Empfehlung | Grad |
|---|---|---|---|---|
| PTMC/PTC | unifokal, pT1a | postoperativer Zufallsbefund, keine lokoregionären/Fernmetastasen, keine Risikofaktoren | keine weitere ablative Therapie (chirurgische/Radioiodtherapie) | A; 1b |
| Papillär (PTC) | pT1a mit Risikofaktoren; | z. B. Multifokalität, aggressiver Subtyp, Organkapselinfiltration, genetisches Risiko, Vorbestrahlung der Kopf-/Halsregion; nach Thyreoidektomie! | Radiojod kann nach Risiko-Nutzen-Abwägung angeboten werden | 0; 2a |
| PTC | pT1a, N1 und/oder M1 | Radiojodtherapie nach Thyreoidektomie | A; 2b | |
| PTC | pT1b, pN0 | ohne Risikofaktoren und bei exzellentem Operationsergebnis | kein Radiojod | B; 1b |
| PTC | pT1b, pN0 | suboptimales OP-Ergebnis | individuell abwägen | B; 1b |
| PTC | pT1b pN0/Nx oder pT2 pN0 | nach prophylaktischer Kompartmentresektion | individuell abwägen | A |
| PTC | pT2 pNx/1 oder pT3 | adjuvantes Radiojod | B | |
| PTC | pT4; jedes N, jedes M | Radiojodtherapie nach Thyreoidektomie | A | |
| PTC | aggressive Subtypen (großzellig, Hobnail-Variante...) | Radiojodtherapie | B, 2b | |
| Follikulär (FTC) | minimal invasiv, ohne Angioinvasion | kein Radiojod | EK | |
| FTC | minimal invasiv, mit Angioinvasion | Radiojodtherapie | EK | |
| FTC | grob invasiv | Radiojodtherapie | EK | |
| Onkozytär | gekapselt; wenige Kapseldurchbrüche, fehlende Angioinvasion, adäquat reseziert | kein Radiojod | EK | |
| Onkozytär | einmalig prüfen, ob therapeutisch nutzbare Radiojodspeicherung gegeben | EK | ||
| schlecht differenziert/ differenziert hochgradig | einmalig prüfen, ob therapeutisch nutzbare Radiojodspeicherung gegeben | B; 2b |
Nachsorge
Insgesamt sollte die Nachsorge bei differenzierten Schilddrüsenkarzinomen mindestens zehn Jahre umfassen. Nach Operation und Radiojodtherapie sollten Halssonografie sowie eine Bestimmung der Tg- und TAK-Werte in den ersten fünf Jahren alle sechs Monate stattfinden, danach reicht ein jährliches Intervall aus (ab zehn Jahren ggf. alle 24 Monate). Haben Erkrankte kein Radiojod erhalten, sollten Mediziner:innen individuelle Nachsorgeintervalle vereinbaren, ebenso gebieten unklare oder suspekte Befunde kürzere Abstände (EK).
Zur Nachsorge zählen obligat eine symptomorientierte Anamneseerhebung und körperliche Untersuchung (EK), ebenso eine Halssonografie (Schilddrüsenbett, zentrale und laterale Lymphabflussgebiete). Auch gehört die Kontrolle der Einstellung mit Schilddrüsenhormonen dazu, die bei stabilem Verlauf jährlich erfolgen sollte (EK).
Liegt die Tg-Serumkonzentration nach abgeschlossener Therapieevaluation unter 0,1–0,2 ng/ml, sollte bei negativem Sonografieergebnis keine weitere Tumordiagnostik erfolgen (B; 2a). Im Fall erhöhter Antikörper gestaltet sich ein Negativbefund in diesem Assay allerdings nicht aussagekräftig (EK).
Metastasen und Rezidive
In der rezidivierten und metastasierten Situation betont das Leitlinienteam, dass das Behandlungskonzept interdisziplinär in einem Tumorboard festgelegt werden soll (EK). Für lokoregionär persistierende oder rezidivierende differenzierte Karzinome (DTC), zervikale Weichteilinfiltrate sowie persistierende/rezidivierende Filiae in den Lymphknoten empfehlen sie ein chirurgisches Vorgehen („sollte“; EK).
Patient:innen mit einem radiojodrefraktären metastasierten DTC, das sich asymptomatisch, stabil oder minimal progredient zeigt, mit geringer Wahrscheinlichkeit eines raschen Progresses und ohne Indikation für eine lokale Therapie, sollen unter TSH-suppressiver Behandlung beobachtet werden (EK). Die Expert:innen empfehlen bildgebende Kontrollen alle 3–12 Monate und ein interdisziplinäres Tumorboard, sobald es zu einem klinisch signifikanten Progress kommt.
Betroffene mit radiojodrefraktärem Schilddrüsenkarzinom können potenziell Sorafenib, Lenvatinib oder Cabozantinib (ab Zweitlinie) erhalten, wenn eine metastasierte, rasch progrediente, symptomatische und/oder lokal unmittelbar bedrohliche Erkrankung ohne sinnvolle lokale Therapiemöglichkeiten vorliegt („soll geprüft werden“; A). In dieser Situation sollen Kolleg:innen vor der Behandlungsentscheidung stets auch eine molekulargenetische Analyse des Tumors veranlassen (EK). Erkrankte mit RET- bzw. NTRK-Fusionen sollten dann den entsprechenden Inhibitor erhalten (EK; B). Liegt eine ALK-Fusion vor, kann ein individueller Heilversuch mit zielgerichteten Hemmstoffen im Tumorboard diskutiert werden (EK), gleiches gilt mutationsunabhängig für die Kombination aus Lenvatinib und Pembrolizumab. Eine „Sollte“-Empfehlung sprach das Leitlinienteam für die Erörterung eines Heilversuchs mit einem BRAF-Inhibitor (ggf. plus Trametinib) aus, wenn sich eine BRAFV600E-Mutation findet (B).
Quelle:
S3-Leitlinie Schilddrüsenkarzinom; AWMF-Register-Nr. 031-056OL; www.awmf.org
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).