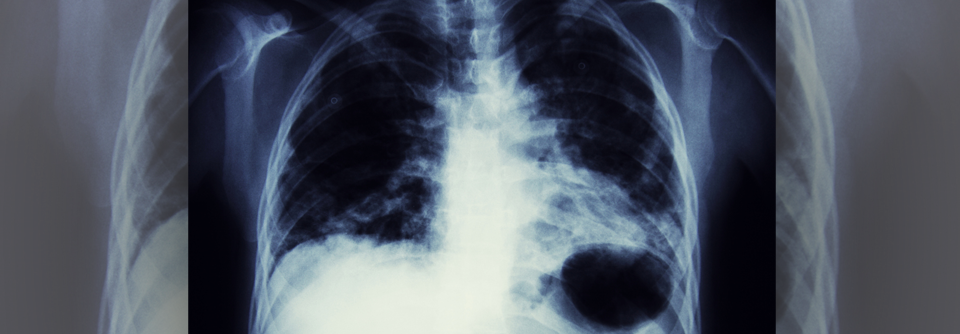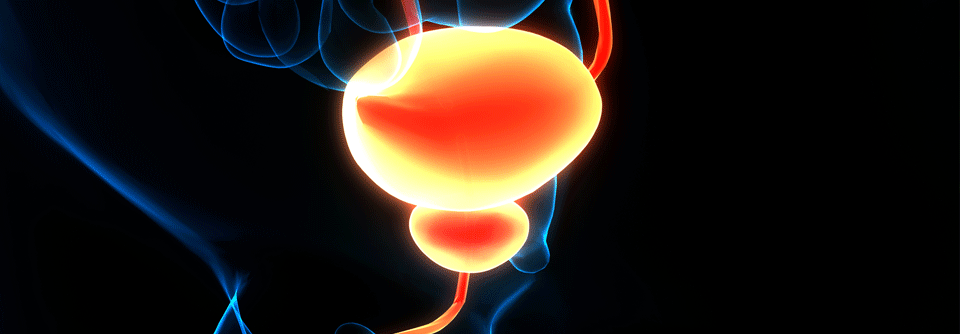Was es bei Menschen unter onkologischer Immuntherapie zu beachten gilt
 Die neuen Wirkstoffe bringen auch ein neues Spektrum an Nebenwirkungen mit sich.
© Markus Spiske - stock.adobe.com
Die neuen Wirkstoffe bringen auch ein neues Spektrum an Nebenwirkungen mit sich.
© Markus Spiske - stock.adobe.com
Mit Einführung der Immuntherapeutika hat die onkologische Systemtherapie einen regelrechten Aufwind erlebt. Die am weitesten verbreitete Substanzgruppe sind die Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI), die bei einer Immuntherapie in der Onkologie zum Einsatz kommt. Darunter werden monoklonale Antikörper zusammengefasst, die sich gegen spezifische Oberflächenmoleküle richten, darunter CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4), PD-1 (programmed cell death-protein 1) sowie dessen Ligand PD-L1 (programmed death-ligand 1).
Die neuen Wirkstoffe bringen auch ein neues Spektrum an Nebenwirkungen mit sich. Die „immune-related adverse events“ (irAE) können geringgradig und reversibel, aber auch schwerwiegend und lebensbedrohlich sein. Marika Princk von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Lübeck und ihr Team erklären, wie man mit den verschiedenen irAE umgeht. Ihrer Ansicht nach sind ein sorgfältiges interdisziplinäres Management und ein frühzeitiges Eingreifen essenziell.
Wann ist mit unerwünschten Ereignissen zu rechnen?
Obwohl irAE unter ICI im Mittel 2–16 Wochen nach Therapiebeginn auftreten, sind auch Monate nach Beendigung der Therapie Spätnebenwirkungen („delayed immune-related events“, DIRE) möglich. Generell kommt es unter einer Kombinationstherapie häufiger und früher zu Nebenwirkungen als unter einer Monotherapie.
Beim Nebenwirkungsmanagement geht es darum, irAE frühzeitig zu identifizieren und zu behandeln, um schwere oder sogar tödliche Ausgänge zu verhindern, so das Autorentrio. Als Voraussetzungen dafür nennen sie unter anderem die ausreichende Kenntnis möglicher Toxizitäten, die umfassende Aufklärung der Therapierten sowie ein Screening auf Risikofaktoren bzw. Leitsymptome im Rahmen des begleitenden Therapiemonitorings.
Welche Therapieoptionen gibt es?
Treten geringfügige Nebenwirkungen (Grad 1) auf, ist in der Regel keine Intervention erforderlich. Die Therapie kann entweder unter einem engmaschigen Monitoring weitergeführt oder kurzzeitig pausiert werden. Im Falle von Nebenwirkungen zweiten Grades wird eine Therapieunterbrechung empfohlen, bis die Nebenwirkungen auf wenigstens Grad 1 abgeklungen sind (Dosissenkungen sind bislang nicht validiert).
Je nach Schwere bzw. Persistenz der Beschwerden kann darüber hinaus erwogen werden, Glukokortikoide zu geben. Eine Frage, die sich bei Nebenwirkungen des Grades 3 bis 4 dagegen nicht mehr stellt: In diesen Fällen ist ein sofortiges Eingreifen i. d. R. über Therapieabbruch und Kortikosteroide angezeigt. Eine Reexposition ist möglich, sollte aber bei irAE > Grad 2 im Tumorboard kritisch diskutiert werden.
Welche Dosen kommen zum Einsatz?
Bei symptomatischen irAE sind Kortikosteroide die Substanz der ersten Wahl. Einzige Ausnahme bilden Menschen mit Endokrinopathien. Das bevorzugte Steroid ist Prednison. Je nach Schweregrad und betroffenem Organ beträgt die empfohlene Dosis 0,5–2 mg/kg/d. Im Falle einer Grad-3- oder -4-Toxizität kann ein Methylprednisolonstoß nötig sein.
Um steroidassoziierte Komplikationen zu vermeiden, sollte man immer eine möglichst niedrige Dosis und die kürzestmögliche Dauer wählen. Danach werden die Steroide über vier bis sechs Wochen ausgeschlichen. Je nach Risikoprofil des Betroffenen kann darüber hinaus eine antibiotische Prophylaxe sowie eine Vitamin-D-Substitution nötig sein.
Bleibt ein Ansprechen auf Kortikosteroide innerhalb von zwei bis drei Tagen aus oder rezidivieren die Beschwerden nach dem Ausschleichen, muss man von einem steroidrefraktären Verlauf ausgehen. In diesen Fällen bietet sich die Hinzunahme von Immunsuppressiva wie Mycophenolatmofetil oder Cyclophosphamid an. Alternativ können Infliximab oder intravenöse Immunglobuline verabreicht werden. Diese Fälle gehören allerdings aufgrund ihrer Komplexität in die Hände von erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten.
Anfangs wurde befürchtet, dass das immunsuppressive Management der irAE die onkologische Therapie negativ beeinflusst. Diese Sorge hat sich bislang nicht bestätigt. Da irAE allerdings durch autoreaktive T-Zell-Klone ausgelöst werden, brauchen Patientinnen und Patienten mitunter eine Art „Immun-Nachsorge mit regelmäßigem Monitoring auch nach Therapieende“, schreibt die Autorengruppe.
Quelle: Princk MH et al. Urologie 2025; DOI: 10.1007/s00120-024-02517-x
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).