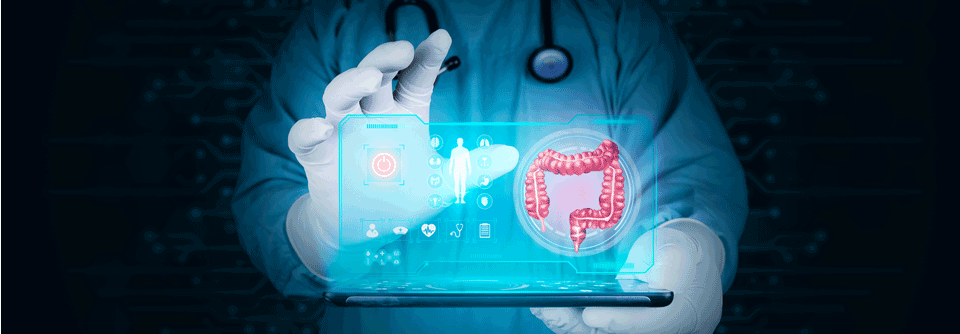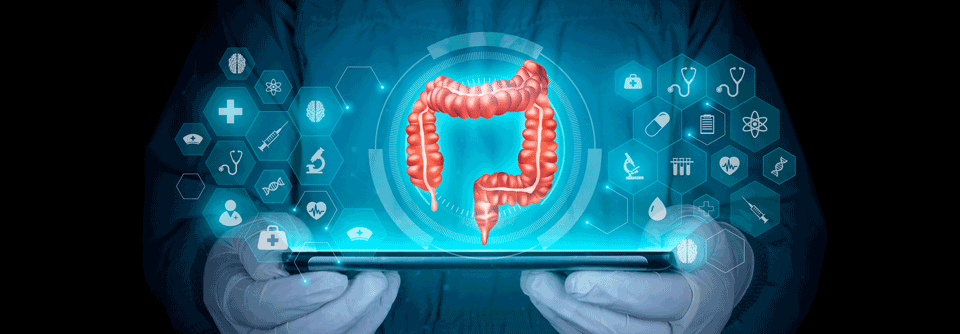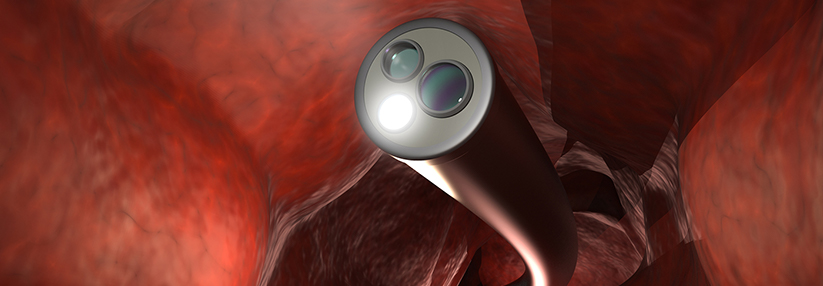
Immuntherapie wirkt auch postoperativ
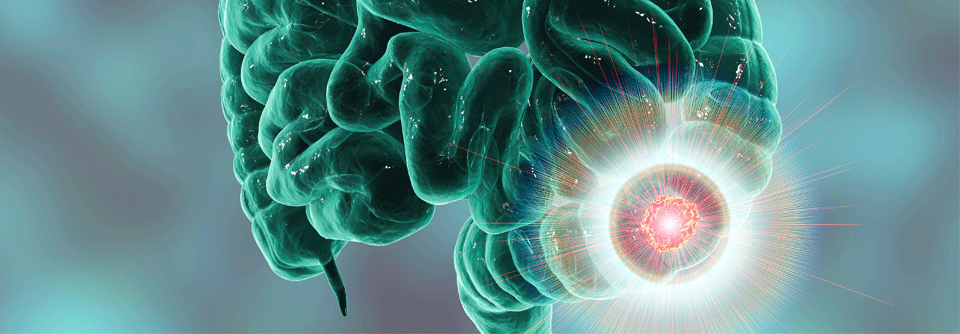 Kolorektale Karzinome mit dMMR zeigen eine deutlich bessere Reaktion auf Immuntherapie als auf die Standardchemotherapie.
© Dr_Microbe – stock.adobe.com
Kolorektale Karzinome mit dMMR zeigen eine deutlich bessere Reaktion auf Immuntherapie als auf die Standardchemotherapie.
© Dr_Microbe – stock.adobe.com
Die Kombination von Atezolizumab mit einer adjuvanten Chemotherapie reduziert nach den Ergebnissen der Phase-3-Studie ATOMIC das Risiko für Rezidiv oder Tod beim defizienten Mismatchrepair(dMMR)-Kolonkarzinom im Stadium III um etwa 50 %, berichtete Professor Dr. Frank Sinicrope von der Mayo Clinic in Rochester.2 An der Studie nahmen 712 Patient:innen mit einem bereits resezierten Adenokarzinom des Kolons im Stadium III (jedes T, N1, 2; M0) und einem zentral bestätigten dMMR-Status (sporadisch oder im Zusammenhang mit einem Lynch-Syndrom) teil.
Randomisiert erhielten sie entweder zwölf Zyklen mFOLFOX6 plus Atezolizumab (840 mg i.v. alle zwei Wochen) gefolgt von weiteren 13 Zyklen Atezolizumab (Gesamttherapiedauer zwölf Monate; n = 355) oder nur die Chemotherapie mit zwölf Zyklen mFOLFOX6 (Therapiedauer sechs Monate, n = 357).
Der primäre Endpunkt der Studie, das krankheitsfreie Überleben (DFS) in der Intent-to-Treat-Population, wurde in einer Interimsanalyse nach median 37,2 Monaten Beobachtung erreicht. Nach drei Jahren betrug die DFS-Rate in der Gruppe mit Atezolizumab und Chemotherapie 86,4 %, in der Gruppe nur mit Chemotherapie 76,6 %. Das entsprach einer Halbierung des Risikos für Krankheitsprogress/Rezidiv oder Tod (HR 0,50; 95%-KI 0,35 – 0,72; p < 0,0001). Subgruppenanalysen bestätigten durchweg den DFS-Vorteil für Atezolizumab plus mFOLOFOX6.
Sicherheitsprofil und Diskussion
Die Immunchemotherapie-Kombination ging mit mehr behandlungsassoziierten unerwünschten Ereignissen des Grads 3–4 einher (72,3 % vs. 59,2 % mit Chemotherapie alleine). In der Gruppe, die mit der Atezolizumab-Kombination behandelt wurde, gab es auch sechs fatale Ereignisse, von denen ein plötzlicher Todesfall und eine Sepsis wahrscheinlich mit der Therapie zusammenhingen. Im Kontrollarm traten zwei Grad-5-Nebenwirkungen auf, keine davon wurde auf die Behandlung zurückgeführt. Prof. Sinicrope bezeichnete das Sicherheitsprofil der Chemoimmuntherapie dennoch insgesamt als gut beherrschbar und wies darauf hin, dass keine neuen Signale aufgetreten seien. Neben mehr Hyperglykämie, Hypothyreose, Diarrhö und Dermatitis ging die Chemoimmuntherapie auch mit mehr nicht-febrilen Neutropenien Grad 4 einher (14,2 % vs. 6,9 % mit mFOLFOX6).
Geplant sind weitere Auswertungen klinischer Endpunkte und eine Analyse potenzieller Biomarker, die Patient:innen mit Ansprechen oder Resistenz charakterisieren könnten. Diese Auswertungen werden wichtig sein, wie Professor Dr. Myriam Chalabi vom Niederländischen Krebsinstitut in Amsterdam diskutierte.3 Sie wies darauf hin, dass in der ATOMIC-Studie 77 % der Patient:innen mit der adjuvanten Chemotherapie nach drei Jahren noch ohne Progress lebten – auch ohne Atezolizumab. Diese seien mit der Kombination potenziell übertherapiert.
Zudem ist unklar, wie die optimale adjuvante Immunchemotherapie aussieht. So könnte bei Menschen mit niedrigem Risiko eine dreimonatige Chemotherapie ausreichen, wie die IDEA-Studie gezeigt hat.4 Die ATOMIC-Studie war vor Publikation dieser Ergebnisse geplant worden, sodass die Chemotherapie für alle Teilnehmenden über sechs Monate erfolgte, obwohl 46 % der Patient:innen in der ATOMIC-Studie ein niedriges Risiko nach Definition der IDEA-Studie hatten.
Fraglich ist auch, wie lange die Gabe der Immuntherapie notwendig ist und ob nicht für einen Teil der Betroffenen eine alleinige adjuvante Immuntherapie ausreichend sein könnte. Dass brachte Prof. Chalabi auf die NICHE-2-Studie, deren herausragende DFS-Ergebnisse mit nur zwei Zyklen einer neoadjuvanten Immuntherapie die Frage aufwirft, ob auf diesem Wege nicht sogar für viele Patient:innen eine organerhaltene Therapie möglich sein könnte – ganz ohne Chemotherapie.
Für die Situation des resezierten Kolonkarzinoms im Stadium III mit dMMR stimmten Prof. Chalabi und Prof. Sincrope aber überein, dass die adjuvante Immunchemotherapie das Potenzial hat, eine neue Standardtherapie für betroffene Patient:innen zu werden.
Quellen:
1. Chalabi M et al. N Engl J Med 2024; 390: 1949-1958; DOI: 10.1056/NEJMoa2400634
2. Frank A. Sinicrope et al. 2025 ASCO Annual Meeting; LBA1
3. Myria Chalabi. 2025 ASCO Annual Meeting; Discussion LBA1
4. Grothey A et al. N Engl J Med 2018; 378: 1177-1188; DOI: 10.1056/NEJMoa1713709
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).