
Krebspatienten unbedingt nach Schlafstörungen fragen!
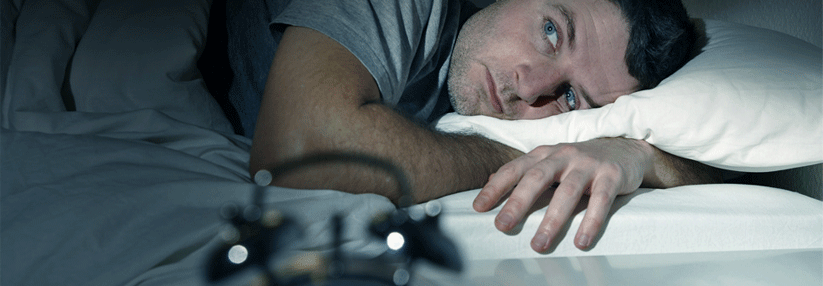 Kaum ein Tumorpatient berichtet aktiv von seinen Schlafstörungen.
© fotolia; Focus Pocus LTD
Kaum ein Tumorpatient berichtet aktiv von seinen Schlafstörungen.
© fotolia; Focus Pocus LTD
Auch jeder dritte gesunde Mensch leidet unter moderaten bis schweren Schlafstörungen. Doch bei Tumorerkrankungen sind etwa 60 % der Patienten betroffen, für das Bronchial- und Mammakarzinom wird sogar noch ein höherer Anteil berichtet, so Professor Dr. Herwig Strik, Universität Marburg.
Auch 18 Monate nach der Primärdiagnose hat immer noch jeder dritte Tumorpatient eine relevante Schlafstörung. "Wenn wir uns um die allgemeine Lebensqualität der Patienten kümmern wollen, dann sind Schlafstörungen ein zentraler Punkt, auf den wir achten sollten", betonte der Neurologe.
Jedoch berichten die Patienten nicht spontan über diese. Prof. Strik: "Sie müssen aktiv fragen – wie schlafen Sie nachts?" Nach seiner Erfahrung werden so plötzlich diverse Beschwerden der Patienten deutlich besser verständlich.
Die Gemengenlage als Ursache der Schlafstörungen kann vielschichtig sein und sollte abgefragt werden (siehe Kasten): Angefangen von physiologischen Faktoren, wie Schmerzen, Husten und Luftnot, über chronobiologische Faktoren, Bewegungsmangel und reduzierte Belastbarkeit, bis hin zu psychologischen Faktoren wie Angst, Stress oder Depression. Als schlafmedizinische Erkrankungen hinzukommen können Schlafapnoe infolge einer Obstruktion, ein Restless-Legs- oder ein Hyperventilations-Syndrom.
Nach Schmerzspitzen in der Nacht fragen
Bei Krebspatienten können zudem die maligne Grunderkrankung selbst sowie therapiebedingte Nebenwirkungen einer Radio- oder Chemotherapie Auslöser für Schlafstörungen sein. Verbreitet unter Krebspatienten sind darüber hinaus Angststörungen oder eine Progredienzangst, betonte Prof. Strik.
Für die Diagnose von Schmerzzuständen empfiehlt er, gesondert nach tageszeitlichen Schwankungen und nächtlichen Schmerzen zu fragen: "Die meisten Patienten leiden nachts am meisten unter den Schmerzen, sodass wir eine eventuelle Schmerzmedikation auch da am stärksten verabreichen sollten."
Fassbare Ursachen möglichst abstellen
Als Grundsatz bei Depressionen und Ängstlichkeit gilt, so der Neurologe: "Schlafstörungen sind eines der Kardinalsymptome bei einer endogenen oder reaktiven Depression. Dies beobachten wir sehr häufig bei unseren Tumorpatienten." Schließlich können auch psychosoziale Probleme den Schlaf rauben – Angst um den Arbeitsplatz oder finanzielle Sorgen.
Ein Hauptprinzip in der Therapie sollte es sein, fassbare Ursachen möglichst gut abzustellen, die sich etwa auf die Medikation, belastende Symptome oder Depressionen zurückführen lassen. So ist die Liste an Substanzen mit Einfluss auf die Schlafqualität sehr lang: Besonders wichtig sind Kortikosteroide, Opiate – die tiefe Schlafphasen reduzieren –, Alkohol, Benzodiazepine oder antriebssteigernde Antidepressiva.
| Auswahl an Fragen zur Schlafanamnese |
|
Ein Beispiel bei Hirntumoren: "Viele Patienten, die in unsere Tumorambulanz kommen, nehmen dreimal täglich Kortikosteroide – legt man die gesamte Dosis auf den Morgen, verbessert sich der Schlaf schon ein wenig", so der Experte. Die zweite Maßnahme, um das Stressniveau der Patienten zu reduzieren und mehr Sicherheit zu vermitteln, kann eine psychoonkologische Betreuung oder eine kognitive Verhaltensberatung sein.
Erst an dritter Stelle folgt die medikamentöse Therapie, die teilweise von einem Psychiater verschrieben werden muss. Er nannte verschiedene Möglichkeiten:
- Als leicht sedierende Schmerztherapie am Abend kommen z.B. Gabapentin 300–600 mg oder Pregabalin 75 mg infrage.
- Als sedierendes Antidepressivum kommt bei vorwiegenden Schlafstörungen nach seinen Angaben Mirtazapin in der geringen Dosis von 7,5–15 mg infrage. "Bei vielen Patienten reicht hier von der kleinsten Tablette die Hälfte aus, um den Schlaf vernünftig anstoßen zu können."
- Kommen Zukunftsängste dazu, so Prof. Strik, sind Neuroleptika wie Melperon (25–50 mg), Pipamperon (20–40 mg) oder Quetiapin (75–150 mg) eine Option.
Einen geringen Stellenwert aus seiner Sicht haben Benzodiazepine und Abkömmlinge. Es sei denn, dass in Ausnahmefällen eine starke Ängstlichkeit vorliegt, die akut entlastet werden muss.
Neue Arbeitsgruppe Schlaf und Tumor
Generell sind die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten in Bezug auf die Therapie sehr unterschiedlich – während manche Patienten von sich aus nach einem Psychoonkologen fragen, lehnen andere eine psychoonkologische oder psychiatrische Betreuung total ab. Bei Patienten, die nachts viel über ihre Tumorerkrankung nachgrübeln, empfiehlt er die Überweisung an einen Psychoonkologen.
Reicht die psychoonkologische Betreuung nicht aus, sollte ein Psychiater gebeten werden, bis hin zur Suizidalität abzuklären und bei Indikation entsprechend medikamentös zu behandeln, erläuterte Prof. Strik. Schwer betroffene Patienten behandelt der Experte im Team, gemeinsam mit einem Psychoonkologen und einem Psychiater.
Um das Thema Schlafstörungen bei Krebserkrankungen besser zu untersuchen, hat sich die Arbeitsgruppe "Schlaf und Tumor" gebildet, an der Schlafmediziner, Psychiater und weitere Fachgruppen beteiligt sind. Ziel ist die Entwicklung eines einfachen Selbstbeobachtungsbogens, der voraussichtlich ab Ende des Jahres in einer multizentrischen Studie angewendet werden kann. Prof. Strik: "Vielleicht gelingt es uns, ein einfaches Screening-Instrument zu entwickeln, mit dem wir betroffene Patienten identifizieren können, damit wir eine gezielte Behandlung einleiten können."
Quelle: 4. Jahreskongress der Arbeitsgemeinschaft Supportive Maßnahmen in der Onkologie, Rehabilitation und Sozialmedizin der Deutschen Krebsgesellschaft (ASORS) 2015, München
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).


