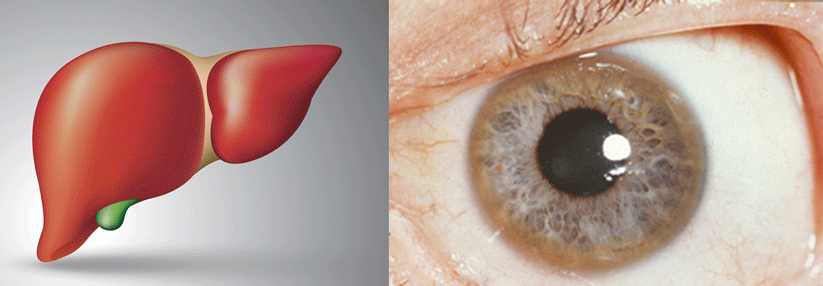
Kupfergefahr für Gehirn und Leber bannen
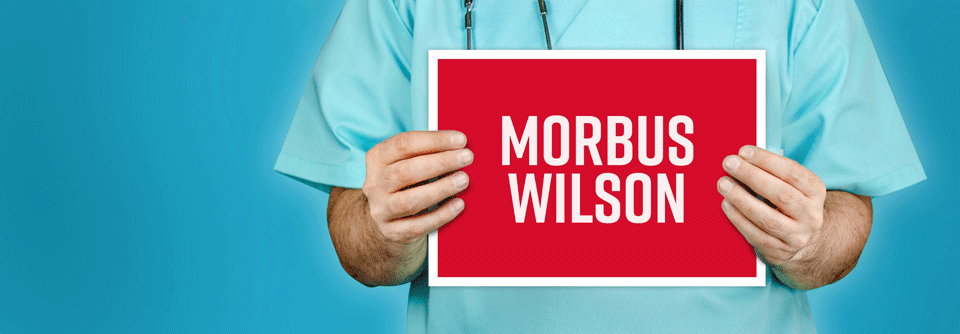 Unbehandelt verläuft der Morbus Wilson oft tödlich.
© MQ-Illustrations - stock.adobe.com
Unbehandelt verläuft der Morbus Wilson oft tödlich.
© MQ-Illustrations - stock.adobe.com
Der M. Wilson ist eine autosomal-rezessive Erkrankung mit gestörter biliärer Kupferexkretion. Auch der Einbau von Kupfer in neu synthetisiertes Coeruloplasmin ist vermindert. Diese Prozesse führen zu einem Anstieg des freien Kupfers im Blut, das sich vor allem in der Leber und im Gehirn ablagert und dort Gewebeschäden verursacht. Neurologisch tritt als Erstes zumeist ein Parkinsonsyndrom oder eine choreoathetoide Dyskinesie auf. Etwa 10 % der Erkrankten haben psychiatrische Symptome.
Die neurologische Form tritt meist erst ab zehn Jahren auf
Wie eine aktualisierte Leitlinie der DGN unter Federführung von Prof. Dr. Wieland Hermann, Spital Langenthal, ausführt, liegt das Manifestationsalter zwischen dem 5. und 45. Lebensjahr. Die neurologische Form des M. Wilson beginnt meist nach dem zehnten Lebensjahr.
Für die klinische Verdachtsdiagnose werden die folgenden Befunde herangezogen:
- Kayser-Fleischer-Ring
- typische hepatische und/oder neurologische Symptome
- erhöhtes Urinkupfer (bei Erwachsenen: ≥ 100 µg/24 h)
- erhöhtes Leberkupfer (> 250 µg/g Trockengewicht)
erniedrigter Serumcoeruloplasminspiegel (< 20 mg/dl) - erniedrigtes Serumkupfer
- Leipzig-Score (s. u.)
- Relatives austauschbares Kupfer > 18,5 % (falls verfügbar)
Die bildgebende Diagnostik ermöglicht zwar keinen Krankheitsnachweis, wohl aber eine Dokumentation des Ausmaßes der zerebralen Beteiligung. MRT-Läsionen treten bereits vor der klinisch-neurologischen Beteiligung auf. SPECT-Befunde belegen prä- und postsynaptische Befunde im nigrostriatalen System nur bei neurologischen Veränderungen. Ergänzend kann – sofern verfügbar – der intravenöse Radiokupfertest (64Cu) die Diagnostik in unklaren Konstellationen unterstützen.
Mehr als 800 pathogene Varianten des „Wilson-Gens“
Die genetische Diagnostik des M. Wilson hat große Fortschritte gemacht. Inzwischen sind mehr als 800 krankheitsassoziierte Varianten im ATP7B-Gen bekannt. Eine pathogene Bedeutung haben diese erst, wenn sie in beiden Allelen vorliegen.
Das „Wilson-Protein“ ATP7B wirkt als transmembraner und intrazellulärer Kupfertransporter mit spiegelabhängiger Modifikation. Es vermittelt die Ausscheidung des Metalls in die Galle.
Eine gesicherte Korrelation zwischen Genotyp und Phänotyp wurde noch nicht gefunden. Trotzdem erlaubt der Nachweis pathogener Varianten das prädiktive Screening von Angehörigen.
Bei jeder extrapyramidalen Bewegungsstörung, v. a. wenn diese vor dem 45. Lebensjahr auftritt, sollte differenzialdiagnostisch an einen M. Wilson gedacht werden. Gleiches gilt für unklare hepatische Steatose, Transaminasenerhöhung und Hyperbilirubinämie.
Ein wichtiges Zeichen ist der Kayser-Fleischer-Kornealring. Sein Fehlen schließt die Erkrankung jedoch nicht aus, v. a. bei Kindern und hepatischem Verlauf. Zur Einordnung unspezifischer Laborbefunde hilft in der Praxis der Leipzig-/Ferenci-Score (Punktesystem aus K-F-Ring, Urin-/Leberkupfer, Ceruloplasmin, Genetik; bei ≥ 4 Punkten gilt die Diagnose als hochwahrscheinlich).
Mangels kausaler Optionen bezweckt die Medikation nur eine Linderung und Prophylaxe der Symptome. Die Initialbehandlung soll eine negative Kupferbilanz erreichen; die Erhaltungstherapie die physiologische Bilanz. Mittel der Wahl sind Chelatbildner (D-Penicillamin oder Trientin) bei neurologisch und hepatisch symptomatischen Kranken. Diese müssen einschleichend dosiert werden, da es andernfalls zu einer paradoxen neurologischen Verschlechterung kommen kann. Präsymptomatische Personen können von Beginn an eine Zinkmedikation erhalten. Diese eignet sich auch für stabile und wenig symptomatische Erkrankte in der Erhaltungstherapie. Unter D-Penicillamin wird zudem eine Pyridoxin-Substitution (20 mg/d) empfohlen.
Basalen Urinkupferwert nach kurzer Therapiepause messen
Eine lebenslange Überwachung des Kupfermetabolismus ist unabdingbar, besonders die renale Ausscheidung des Metalls im 24-Stunden Sammelurin (Kontrolle ein- bis zweimal jährlich). Unter Chelator-Therapie soll zunächst der basale Urinkupferwert nach 2-tägiger Medikamentenpause erhoben werden (Zielwert < 100 µg/d); unter Zink ist keine Pause nötig. Bei der Messung unter laufender Medikation gelten wirkstoffspezifische Zielbereiche.
Die Behandlung darf nie über einen längeren Zeitraum unterbrochen werden – andernfalls droht eine Kupferakkumulation mit dem Risiko eines akuten, lebensbedrohlichen Leberversagens. Das gilt auch für die Schwangerschaft, in der Chelatbildner und Zinksalze nach aktueller Kenntnis von Schwangerer und Ungeborenem gut toleriert werden. Im letzten Trimenon empfiehlt die Leitlinie eine Reduktion der Chelator-Dosis auf ca. 2/3 des Ausgangswerts.
cMRT-Kontrolle ermöglicht Ausschluss anderer Prozesse
Als neurologisch bildgebende Verfahren zur Verlaufskontrolle bei M. Wilson dient vor allem die cMRT, eventuell auch die elektrophysiologische Diagnostik. Nach einer Basisuntersuchung zu Therapiebeginn folgt die erste cMRT-Kontrolle nach 24 Monaten. Sie ermöglicht den Ausschluss anderer hirnorganischer Prozesse. Im Verlauf genügt eine Beobachtung alle vier bis sechs Jahre, sofern keine neurologische Verschlechterung erfolgt.
Ein genetisches Familien-Screening für Angehörige der Erkrankten ist der Leitlinie zufolge obligat. Das gilt für sämtliche Geschwister und Kinder (Risiko 1:4 bzw. 1:200). Die Diagnostik bei Verdacht oder bei positiver Familienanamnese erfolgt üblicherweise ab einem Alter von vier bis fünf Jahren.
Im Fall einer akuten hepatischen Insuffizienz besteht eventuell die Indikation für eine Lebertransplantation. Fallserien zeigen bei gut selektierten Personen mit isoliert neurologischem M. Wilson eine Besserung der Symptome nach Organersatz. Als Bridging-Maßnahme in der Hochrisikosituation hat sich der Hochvolumen-Plasmaaustausch (HVPE) etabliert.
Quelle: S1-Leitlinie „Morbus Wilson“; AWMF Register-Nr. 030/091; www.awmf.org
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).
