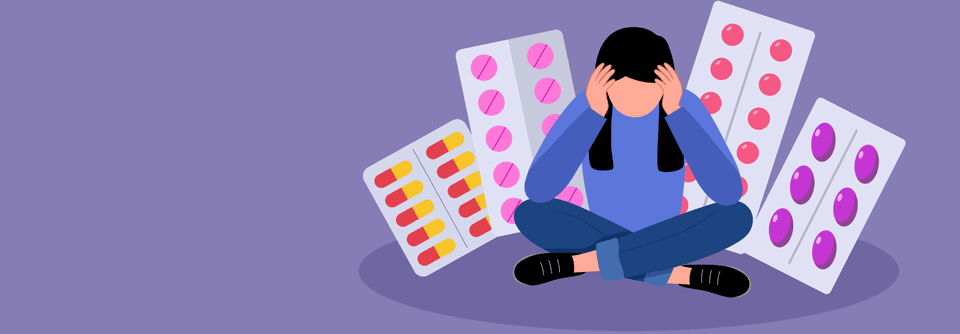Management der chronischen Herzinsuffizienz
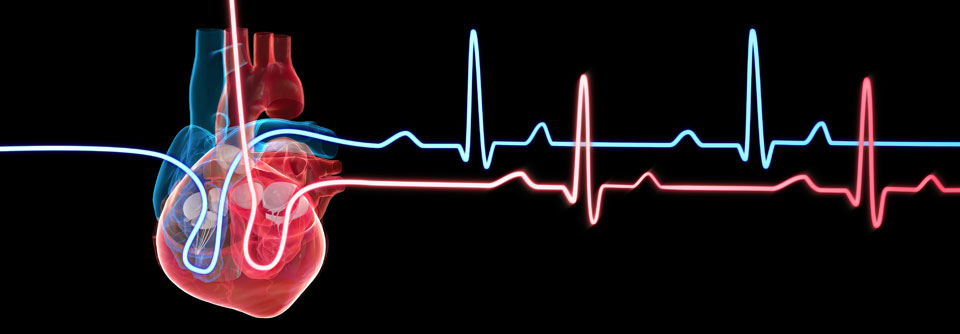 Auch bei respiratorischen Erkrankungen besteht die Gefahr der Entwicklung einer Herzinsuffizienz.
© TuMeggy – stock.adobe.com
Auch bei respiratorischen Erkrankungen besteht die Gefahr der Entwicklung einer Herzinsuffizienz.
© TuMeggy – stock.adobe.com
In der allgemeinmedizinischen Praxis kann sich hinter vielen Beratungsanlässen auch eine chronische Herzinsuffizienz verbergen. Bei Patientinnen und Patienten mit respiratorischen Erkrankungen ist die Gefahr besonders groß, eine Herzinsuffizienz zu übersehen. Daher plädiert ein Autorenteam um Dr. Rachel Roskvist von der Universität Auckland dafür, bei Betroffenen mit Luftnot generell einen kardialen Status zu erheben.
Basisuntersuchungen in der Hausarztpraxis beinhalten EKG, Überweisung zum Röntgen-Thorax, Bestimmung von BNP oder pro-BNP sowie Blutbild, Kreatinin, Harnstoff, Elektrolyte, Schilddrüsenwerte, Leberwerte, HbA1c, Ferritin und Eisenwerte. Ergänzend können ein Troponin-Test oder eine Ultraschalluntersuchung der Lunge und des Herzens möglicherweise direkt in der Hausarztpraxis sinnvoll sein.
Eine Echokardiografie ist für die Diagnose und Klassifizierung einer Herzinsuffizienz und insbesondere der LVEF unerlässlich. Ist diese Untersuchung zeitnah nicht möglich, kann bis zur definitiven Diagnose eine Behandlung mit Diuretika, evtl. auch mit SGLT2-Inhibitoren ,begonnen werden, schreiben die Autoren.
Bei der Therapie der Herzinsuffizienz mit reduzierter LVEF haben sich vier Wirkstoffklassen in Studien bewährt. RAAS-Inhibitoren, Betablocker, Aldosteron-Antagonisten (MRA) und SGLT2-Hemmer senken Mortalität und Hospitalisierungsrate. In der Kombination scheint sich der Effekt noch zu verstärken. Damit die Kombinationstherapie schneller ihre synergistische Wirkung entfaltet, können auch mehrere Substanzen in niedriger Einstiegsdosierung parallel begonnen und aufdosiert werden. Vor dem Einstieg mit ACE-Hemmern, Angiotensin-II-Rezeptorblockern (ARB), ARNI oder MRA sollte die eGFR über 30 ml/min/1,73 m² liegen und das Serumkalium unter 5,4 mmol/l. Zudem ist für eine Therapie mit blutdrucksenkender Wirkung, ein Ausgangsblutdruck von mindestens 100 mmHg systolisch empfohlen.
Eine Möglichkeit des Therapiestarts ist der schnelle Behandlungseinstieg: Dabei beginnt man gleichzeitig mit einem Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor (ARNI) und einem SGLT2-Inhibitor in niedriger Dosierung und ergänzt nach einigen Tagen Betablocker und MRA. Anschließend werden alle vier Medikamente in ihrer Dosis gesteigert. Dieses Vorgehen ist für die Primärversorgung stabiler Patient:innen empfohlen, Studien zu weiteren Konzepten dieser Art fehlen noch.
Zur Behandlung einer Herzinsuffizienz mit erhaltener LVEF liegt für SGLT2-Hemmer eine starke Evidenz vor. Die anderen pharmakologischen Substanzen, die bei reduzierter LVEF zum Einsatz kommen, sind bei Betroffenen mit erhaltener LVEF offenbar weniger wirksam. Bei ihnen steht die Behandlung der Komorbiditäten im Vordergrund.
Nicht-medikamentöse Therapie
Psychosoziale Begleitung von Erkrankten und Angehörigen, Sport- und Bewegungsprogramme mit medizinischer Supervision und ausreichende Nahrungsaufnahme wirken sich positiv auf den Krankheitsverlauf aus. Die Restriktion der Trinkmenge sollte sich nach aktuellen Erkenntnissen auf akute Exazerbationen oder das Vorliegen einer Hyponatriämie beschränken.
Wird ein bestehender Eisenmangel behandelt, so verbessert sich die Lebensqualität von Herzinsuffizienz-Patientinnen und -Patienten und die kardiovaskulärbedingte Mortalität und Hospitalisierung wird reduziert. Im Gegensatz dazu können Medikamente wie z. B. NSAR, Glukokortikoide, Trizyklische Antidepressiva und Alphablocker, eine Herzinsuffizienz verschlechtern.
In Verlaufsuntersuchungen sollten Halsvenenstauung, Auskultation von Herz und Lunge, Herzfrequenz und Blutdruck evaluiert werden (z. B. alle sechs Monate). Regelmäßige Laborkontrollen mit Blutbild, Elektrolyten und Nierenwerten sind ebenfalls empfohlen. Auf wiederholte pro-BNP/BNP-Bestimmungen kann bei stabilen Patienten verzichtet werden. Betroffene können geschult werden, ihre Diuretikatherapie auf Basis von Körpergewicht und Ödemen in einem abgestimmten Rahmen selbst anzupassen. Hier leistet die Telemedizin einen wertvollen Beitrag.
Die Autoren sprechen sich zudem dafür aus, mit Betroffenen und Angehörigen über eventuell gewünschte Therapielimitierungen oder palliatives Vorgehen zu sprechen, da sich eine Herzinsuffizienz auch ohne Vorzeichen rasch verschlechtern kann.
Quelle: Roskvist R et al. BMJ 2024; 384: e077057; DOI: 10.1136/bmj-2023-077057
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).