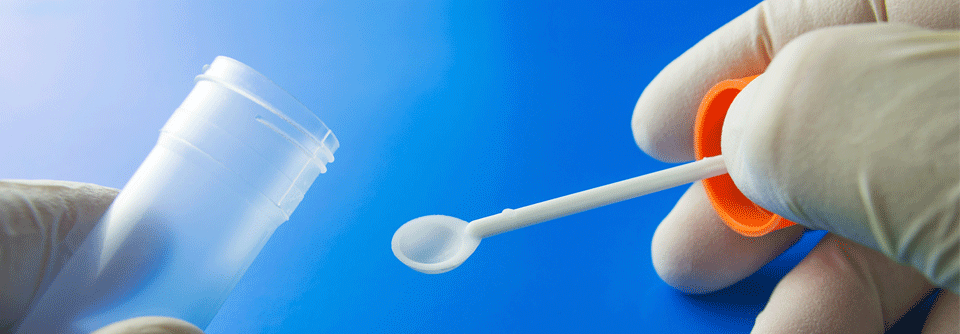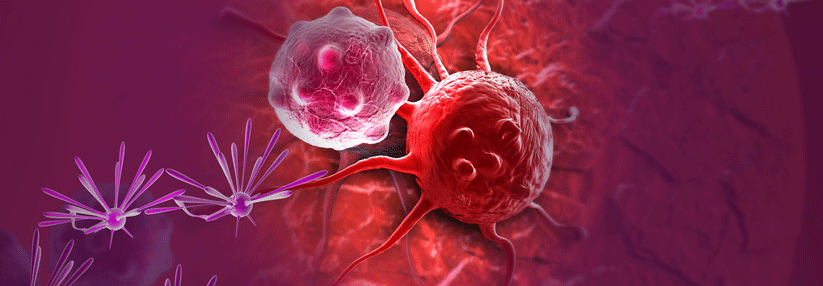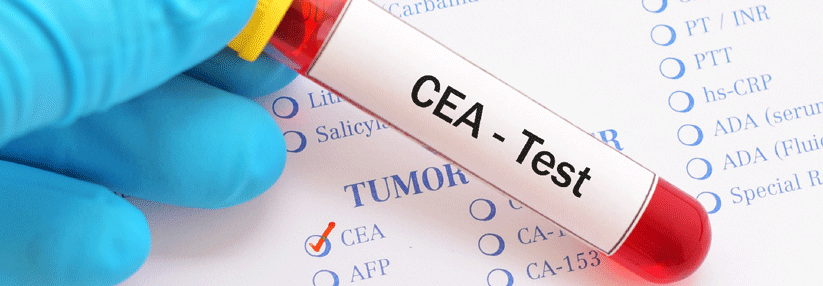
Maßgeschneiderte Nachsorge für Personen mit kolorektalem Karzinom
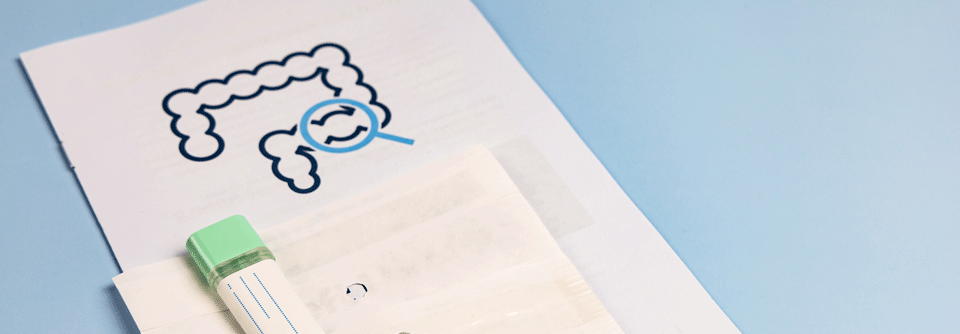 Die ctDNA ermöglicht eine individualisierte Nachsorge bei Darmkrebs und prognostiziert Rezidive besser als der CEA-Wert.
© Kassandra – stock.adobe.com
Die ctDNA ermöglicht eine individualisierte Nachsorge bei Darmkrebs und prognostiziert Rezidive besser als der CEA-Wert.
© Kassandra – stock.adobe.com
Die Testung auf zirkulierende Tumor-DNA kann unter anderem in der Nachsorge des kolorektalen Karzinoms (CRC) eingesetzt werden. Damit sollen ein Rezidiv oder Progress früh erkannt werden. Vielleicht lässt sich aber auch anhand der ctDNA für einige Patient:innen mit anhaltend negativem Test die Nachsorge verkürzen. Prof. Dr. Arvind Dasari vom MD Anderson Cancer Center in Houston forderte jedenfalls eine maßgeschneiderte Nachsorgestrategie.1
Die bisherige Kontrolle mithilfe des des Tumormarkers CEA, der Koloskopie und der Computertomografie über fünf Jahre hätten beim CRC kaum einen Vorteil geboten, ist sein Argument. Die ctDNA habe eine höhere prognostische und prädiktive Genauigkeit als CEA, erläuterte Prof. Dasari anhand zweier prospektiver Beobachtungsstudien. Untersucht wurde bei CRC-Patient:innen die Rate der potenziell kurativen metastasengerichteten Therapie (MDT) im Verlauf als Indikator für die Erkennung einer Oligometastasierung vor weiterer Ausbreitung.
OS-Daten stehen noch aus
Damit die intensivierte Nachsorge Eingang in die Praxis finden kann, sind Ergebnisse zum Gesamtüberleben nötig, kommentierte Prof. Dr. Jeanne Tie, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, die Studienergebnisse. Sie schloss nicht aus, dass bei anhaltender ctDNA-Negativität die Zeit bis zur statistischen Heilung und damit die Dauer der Nachsorge verkürzt werden kann.
Quelle:
Tie J. ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2025; Vortrag „Invited discussant LBA1, 2O and 3O“
An der Studie GALAXY nahmen Erkrankte mit CRC im Stadium II-IV teil. Die MDT-Rate betrug in der Gruppe mit Stadium-II-III-Tumoren nach median 23 Monaten bei mindestens einem positiven ctDNA-Test 32 %, im Falle von anhaltender ctDNA-Negativität 2,2 %. Die entsprechenden MDT-Raten im Stadium IV erreichten 41,0 % und 8,6 %. Der CEA-Status war im Stadium II/III weniger deutlich für die MDT-Rate relevant (CEA-positiv: 10,6 %; negativ: 4,6 %) und im Stadium IV gar nicht aussagekräftig (CEA-positiv: 20,0 %; negativ 19,6 %).
An der Studie BESPOKE-CRC nahmen nur Patient:innen mit einem Tumor im Stadium II/III teil. Nach median 23,9 Monaten belief sich die MDT-Rate bei ctDNA-Positivität auf 21,6 % und in den ctDNA-negativen Kontrollen auf 1,0 %. Die intensivierte Nachsorge mit regelmäßiger ctDNA-Testung verbessert die Chance auf eine kurative MDT, resümierte Prof. Dasari.
Früherkennung durch ctDNA-Monitoring
Die molekularen Rezidive waren in beiden Studien am häufigsten in den ersten 18 Monaten der Nachsorge aufgetreten. In BESPOKE-CRC betrug die Rate bei nur vorübergehend ctDNA-negativen Patient:innen nach zwölf Monaten 72 % und nach 18 Monaten 93 %. In GALAXY entwickelte die Gruppe mit transienter ctDNA-Freiheit je nach Stadium zu 64–75 % innerhalb von zwölf Monaten und zu 90–100 % innerhalb von 18 Monaten ein molekulares Rezidiv. In der Gruppe der Erkrankten mit Tumoren im Stadium II/III und anhaltend negativen ctDNA-Testergebnissen in BESPOKE-CRC kam es nach 18 Monaten zu einem Rezidiv (Rate 0,1 %). In der GALAXY-Studie erreichte die Rezidivrate zu diesem Zeitpunkt 1,5 %. Prof. Dasari geht davon aus, dass Personen mit CRC im Stadium II/III, die bei serieller ctDNA-Testung über 18 Monate anhaltend negativ bleiben, wahrscheinlich kein Rezidiv mehr entwickeln werden. Er plädierte daher für das longitudinale ctDNA-Monitoring.
Forschende prüfen in der Studie FIND prospektiv, ob das regelmäßige Monitoring mit einem tumoragnostischen ctDNA-Test auf Basis der DNA-Methylierung die Nachsorge des nicht-metastasierten CRC verbessern kann. Die Testung erfolgte im Prüfarm über zwei Jahre hinweg alle drei Monate, berichtete Prof. Dr. Junjie Peng, Fudan University Shanghai Cancer Center.2 War der ctDNA-Test positiv, wurde eine Bildgebung durchgeführt und bei positivem Befund eine MDT diskutiert. Die Standardnachsorge erfolgte im experimentellen wie im Kontrollarm über fünf Jahre mit CEA, Koloskopie und CT.
In der Prüfgruppe entwickelten 8,3 % ein Rezidiv, in der Kontrolle 10,5 %. Die ctDNA-unterstützte Überwachung verdoppelte den Anteil der Rezidive, die kurativer behandelt werden konnten (50 % vs. 22,6 %). Das war vor allem auf mehr kurativ intendierte Therapien aufgrund von Lebermetastasen zurückzuführen. Die Zeit bis zur Diagnose eines klinischen Rezidivs war mit der ctDNA-Kontrolle um etwa drei Monate kürzer als bei einer Standardnachsorge.
Quelle:
1. Dasari A et al. ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2025; Abstract 2O
2. Peng J et al. ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2025; Abstract LBA1
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).