
Nebenwirkungen von Opioiden gezielt behandeln
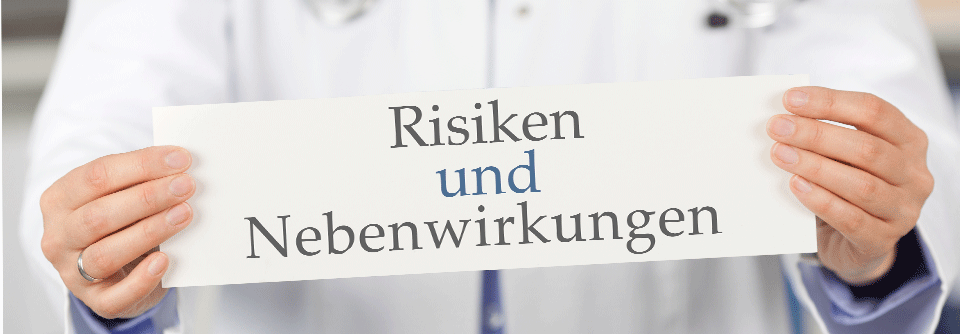 Verstopfung, Übelkeit, Juckreiz, Endokrinopathien: Eine chronische Opioidtherapie kann mit etlichen unerwünschten Effekten einhergehen.
© contrastwerkstatt - stock.adobe.com
Verstopfung, Übelkeit, Juckreiz, Endokrinopathien: Eine chronische Opioidtherapie kann mit etlichen unerwünschten Effekten einhergehen.
© contrastwerkstatt - stock.adobe.com
Verstopfung, Übelkeit, Juckreiz, Endokrinopathien: Eine chronische Opioidtherapie kann mit etlichen unerwünschten Effekten einhergehen. Darüber sollten Schmerzkranke von Anfang an Bescheid wissen. Dies erleichtert u. a. das gezielte Gegensteuern.
Bis zu 97 % der Menschen, die aufgrund einer Krebserkrankung Opioide verschrieben bekommen, entwickeln eine Obstipation. Dennoch wird sie nur selten diagnostiziert und behandelt, bemängeln Dr. Alexandra Barnes, die in einem Hospiz des Liverpool University Hospital Foundation Trust tätig ist, und weitere Forschende. Sie fordern daher eine prophylaktische Behandlung ab dem Start der intensiven Schmerztherapie. Zunächst wird ein stimulierendes Laxans verschrieben und gegebenenfalls bis zur maximal möglichen Dosis titiert. Zeigt sich nach 3–4 Tagen unter der Höchstdosis kein positiver Effekt, kommt ein osmotisch wirksames Abführmittel dazu.
Wenn Klysmen nicht reichen kann Naloxegol helfen
Erweist sich auch diese Maßnahme als unzureichend, kann man auf Suppositorien oder Klysmen zurückgreifen. Peripher wirksame µ-Opioidrezeptorantagonisten (PAMORA) wie Naloxegol und Naldemedin kommen nach Auffassung der Kolleginnen und Kollegen erst dann zum Einsatz, wenn die konventionelle laxative Therapie gescheitert ist. Anderen Empfehlungen zufolge sind diese Substanzen prinzipiell eine Option bei opioidinduzierter Verstopfung.
Übelkeit und Erbrechen treten häufig nur in den ersten Tagen einer Opiatbehandlung auf, um dann spontan zu sistieren. Betroffen sind etwa 25–40 % der Patientinnen und Patienten. Halten die Beschwerden länger an, ist die Gabe von Antiemetika sinnvoll. Für welche Substanz man sich entscheidet, hängt von der möglichen pathophysiologischen Ursache der Symptome und Begleiterkrankungen ab. So bietet sich z. B. Metoclopramid bei gastroparesebedingten postprandialen Symptomen wie frühem Sättigungsgefühl oder Blähungen an. Bei dopaminvermittelten Beschwerden, etwa Reflux, unregelmäßig auftretendem Erbrechen und Schluckauf, rät das Autorenteam zu Domperidon oder Haloperidol. Beide Wirkstoffe blockieren D2-Rezeptoren sowohl in der Peripherie als auch im zerebralen Brechzentrum. In der Area postrema des Hirnstamms entfalten auch der Neurokinin-Rezeptor-Antagonist Aprepitant und 5-HT3-Rezeptorantagonisten wie Ondansetron und Granisetron ihre Effekte.
Bewegungsassoziiertes Erbrechen und Schwindel kann man mit einem H1-Rezeptorantagonisten, Cyclizin (in Deutschland nicht auf dem Markt), Scopolamin oder zentral wirksamen Muskarinrezeptorantagonisten behandeln.
Unter einer chronischen Opiattherapie drohen auch Endokrinopathien. Man schätzt, dass bis zu 50 % der Patientinnen und Patienten von einem hypogonadotropen Hypogonadismus betroffen sind, außerdem kann es zu einer sekundären Niereninsuffizienz oder einer Hyperprolaktinämie kommen. Allerdings werden die resultierenden Symptome zu selten der Schmerztherapie zugeschrieben. Eine sexuelle Dysfunktion bzw. ein Cortisoldefizit lässt sich mittels Hormonersatz behandeln – sofern das Absetzen der Opioide oder ein Substanzwechsel nicht in Betracht kommt. Ist es bereits zur Reduktion der Knochendichte gekommen, sollte man eine entsprechende spezifische Therapie erwägen.
Sedierende Effekte verschwinden meist wieder
Sedierung durch Opioide ist zumeist nur initial und bei Dosissteigerung ein Problem. Der Grund dafür ist, dass der Körper normalerweise eine Toleranz gegenüber den sedierenden Effekte entwickelt. Verstärkt sich das Symptom jedoch trotz stabiler Einstellung, lohnt der Blick auf die eingenommene Dosis, die Nierenfunktion und evtl. neu dazugegebene Medikamente. Bei anhaltender Sedierung ohne erkennbare Ursache ist der Opioidwechsel eine Option.
Deutlich seltener als die bereits genannten Nebenwirkungen ist der opioidinduzierte Juckreiz, der u. a. durch eine Histaminausschüttung verursacht wird. Zur Therapie bieten sich nach Aussage von Dr. Barnes und ihrer Koautoren mentholhaltige Cremes, H1-Rezeptorantagonisten, 5-HT3-, D2-Rezeptor- sowie GABA-Antagonisten an.
Quelle: Barnes A et al. Clinical Medicine 2025; doi: 10.1016/jclinme.2025.100330
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).


