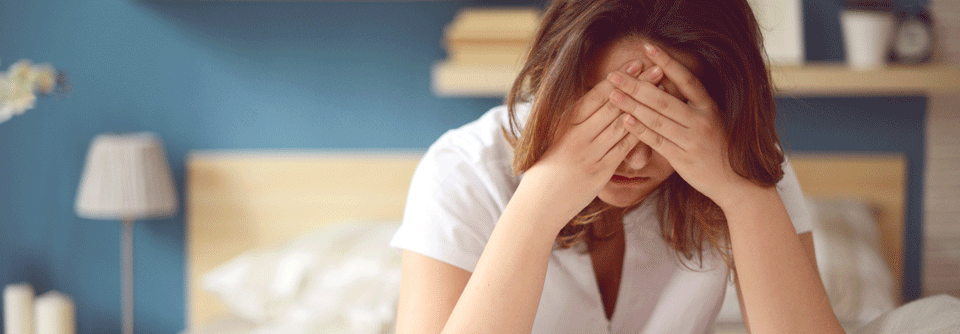PAIVS: Wenn Infekte Kinder langfristig ausbremsen
 Postakute Infektionssyndrome können nach Covid-19, aber auch nach Mononukleose oder Influenza auftreten.
© Dominik Rueß - stock.adobe.com
Postakute Infektionssyndrome können nach Covid-19, aber auch nach Mononukleose oder Influenza auftreten.
© Dominik Rueß - stock.adobe.com
Postakute Infektionssyndrome können nach COVID-19, aber auch nach Mononukleose oder Influenza auftreten. Kinder und Jugendliche können ebenfalls erkranken, wenn auch seltener als Erwachsene. Neben der individuellen Behandlung brauchen betroffene Familien oft sozialmedizinische Unterstützung, beispielsweise bei Schulfragen.
Unspezifische chronische Symptome, die im Anschluss an Infektionskrankheiten entstehen, bezeichnet man als postakutes Infektionssyndrom (PAIS). Auch ein postakutes Vakzinierungssyndrom kommt vor, jedoch sehr viel seltener.
Zusammengefasst spricht man von postakuten Infektions- und Vakzinierungssyndromen (PAIVS). Über die Schwierigkeiten der Versorgung von Kindern mit solchen Symptomkomplexen berichten Dr. Jeremy Schmidt, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Bielefeld, und seine Kolleginnen und Kollegen.
Für das Post-Covid-Syndrom gibt es eine speziell auf Kinder bezogene Definition von der WHO: Es tritt innerhalb der ersten drei Monate nach einer SARS-CoV-2-Infektion auf und hält mindestens zwei Monate lang an. Dabei kann es eine symptomlose Pause nach der Akutinfektion geben, muss es aber nicht. Die Beschwerden sind vielgestaltig. Häufig kommen Fatigue, Dyspnoe, Belastungsintoleranz, Schmerzen und Ängstlichkeit vor. Je nach Schweregrad können die Kinder nicht mehr die Schule besuchen oder sind schlimmstenfalls pflegebedürftig.
Als besonders schwere Form von PAIS gilt das myalgische Enzephalomyelitis/chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Betroffene leiden unter Fatigue und Belastungsintoleranz mit postexertioneller Malaise. Darunter versteht man ein Gefühl der Erschöpfung nach physischen oder psychischen Belastungen, die vor der Erkrankung problemlos bewältigt wurden, z. B. Treppensteigen oder kurze Gespräche. Zum ME/CFS gehören ausserdem unerholsamer Schlaf, Schmerzen sowie neurokognitive (Brain Fog), autonome, neuroendokrine und/oder immunologische Manifestationen. Die Symptome halten mindestens drei Monate lang an.
Symptome am besten per Fragebogen erfassen
Bei der Diagnostik ist man darauf angewiesen, die Symptome genau zu erfassen, Biomarker gibt es nicht. In erster Linie kommt es darauf an, Differenzialdiagnosen und Komorbiditäten abzugrenzen, z. B. eine Myokarditis oder ein Guillain-Barré-Syndrom. Bei der Anamnese sind spezifische Fragebögen hilfreich wie der DePaul Symptom Questionnaire – Post-Exertional Malaise beim gleichnamigen Symptomkomplex oder der Munich Berlin Symptom Questionnaire bei ME/CFS.
Fragen sollte man u. a. nach Müdigkeit, kognitiven Beeinträchtigungen und Schlafstörungen sowie Autoimmunerkrankungen oder PAIVS in der Familie.
Liegt eine postexertionelle Malaise vor, müssen die auslösenden Alltagsaktivitäten eruiert werden. Möglicherweise berichten die von einem PAIVS betroffenen Kinder auch von Angst vor dem Aufstehen aufgrund von Herzrasen. Dann könnte ein posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom vorliegen, das sich mit einem Zehn-Minuten-Stehtest aufdecken lässt. Außerdem kommt eine orthostatische Hypotonie, also ein anhaltender Blutdruckabfall nach dem Aufrichten über 20 mmHg bzw. auf unter 90 mmHg systolisch, vor.
Die Behandlung soll die Symptome lindern und die Teilnahme an Alltagsaktivitäten verbessern. Bei postexertioneller Malaise kann die Strategie des sogenannten Pacings helfen. Dabei werden Anstrengungen so dosiert, dass es möglichst nicht zu Überlastungen kommt und trotzdem eine Teilnahme an Alltagsaktivitäten und Schule weitestgehend ermöglicht wird. Diese Methode wird als Selbstmanagement und in individuellen Schritten angewandt. Vordefinierte Trainingsstufen sind kontraproduktiv.
Beschwerden haben mitunter Folgen für die Psyche
Weitere nichtmedikamentöse Therapiemethoden bei PAIVS beinhalten Physio-, Atem-, Ergo-, Schmerz- und Psychotherapie. Schwere Symptome können zu Angst und Depression führen und die ganze Familie stark belasten. Daher ist eine begleitende psychotherapeutische und/oder psychiatrische Unterstützung wichtig. Zudem benötigen die betroffenen Familien häufig sozialmedizinische Hilfe, beispielsweise bei Fragen nach Schulformwechsel, Versetzung oder Gefährdung von Abschlüssen. Wenn möglich, sollten die Kinder im gewohnten Klassenverband verbleiben. Mögliche schulische Nachteile können eventuell durch eine flexible Unterrichtsdauer oder Haus- bzw. Onlineunterricht ausgeglichen werden.
Eine kausale medikamentöse Therapie gibt es nicht. Einzelne Symptome lassen sich mit Medikamenten lindern. Für eine Off-Label-Verordnung, beispielsweise bei schweren Schlaf- und Kreislaufstörungen, chronischen Schmerzen oder Fatigue, sollte man sich von spezialisierten Versorgungszentren beraten lassen.
PAIVS bei Kindern und Jugendlichen erfordern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Diagnostik und Therapie, betonen die Autorinnen und Autoren. Mit dem Projekt „Pädiatrisches Netzwerk für die Versorgung und Erforschung von postakuten Folgen von COVID-19, ähnlichen postakuten Infektions- und Impfsyndromen sowie ME/CFS bei Kindern und Jugendlichen“ (PEDNET-LC) soll die Versorgung Betroffener verbessert werden. Das Vorhaben wird vom Bundesgesundheitsministerium gefördert.
Quelle: Schmidt J et al. Monatsschr Kinderheilkd 2025; 173: 628-636; doi: 10.1007/s00112-025-02222-9
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).