
Cartoon Gesundheitspolitik
Sachverständige müssen medizinische und rechtliche Themen streng trennen
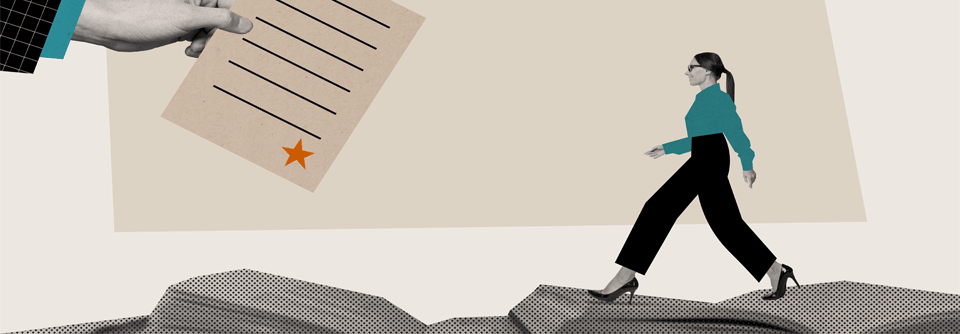 Arzthaftungsverfah- ren gibt es in Deutschland seit 1894. Im Fokus stehen dabei Behandlungsfehler und Aufklärungsfehler.
© deagreez - stock.adobe.com
Arzthaftungsverfah- ren gibt es in Deutschland seit 1894. Im Fokus stehen dabei Behandlungsfehler und Aufklärungsfehler.
© deagreez - stock.adobe.com
Der Mediziner Dr. Thomas Konkel begutachtet die Leistung von Kolleginnen und Kollegen seit 2007 als Gerichtssachverständiger. Der Ausgangspunkt für ein Arzthaftungsverfahren sei in der Regel, dass z. B. ein Patient einen Behandlungsfehler geltend macht, weil ihm ein Schaden entstanden ist. „Das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte“, so der Chirurg. Manchen Patientinnen oder Patienten würde eine Behandlung vielleicht nicht gefallen, aber ohne Schaden sei es kein Behandlungsfehler.
Eine Vermischung der Fachgebiete ist nicht zulässig
In der Begutachtung werde nicht „der Weg nach Rom“ betrachtet, sondern wie die Patientin bzw. der Patient in Rom ankomme: „Ist auf dem Weg zum Behandlungsende kein Schaden durch unsinnige Behandlung entstanden, der Heilverlauf nicht bewusst verzögert worden und sind keine besonderen Kosten entstanden – zusätzliches Verdienen am Patienten –, ist ein Behandlungsfehler sehr unwahrscheinlich.“ Zu beachten sei im Gutachten, dass ein Behandlungsfehler Schadenursache sein kann, es sich aber auch um die Folge einer tragischen oder üblichen Komplikation wie Lungenembolie, Endoprotheseninfektion, Materialdefekt, Versagen technischer Geräte handeln könne. Eine Differenzierung zwischen Komplikation und Schaden sei wichtig.
Dr. Konkel weist auf weitere Vorgaben für die Gutachtertätigkeit hin:
- Der/die Begutachtende muss über Fach- und Sachkunde verfügen. Eine Vermischung der Fachgebiete ist nicht zulässig. Beispiel: Ein Chirurg darf kein Gutachten auf urologischem Gebiet erstellen.
- Begutachtet werden muss nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Neue Forschungsergebnisse, die noch nicht validiert sind und nicht zum Goldstandard zählen, dürfen zwar erwähnt werden, aber nicht Grundlage der Beurteilung sein.
- Sachverständige müssen nicht nur den medizinischen, sondern auch den juristischen Hintergrund kennen. Die Trennung zwischen Medizin und Jura sei im Gutachten aber zu beachten: Der Jurist macht die rechtlichen, die Ärztin die medizinischen Ausführungen. In ein medizinisches Gutachten gehören im Regelfall keine juristischen Begriffe.
Vergessen sollten Sachverständige den Satz „eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus“. „Wir müssen absolut objektiv sein“, mahnt Dr. Konkel. „Auf gar keinen Fall dürfen Sie ein Gefälligkeitsgutachten erstellen.“ Das Schonen einer Kollegin oder eines Kollegen durch ein fachlich falsches Gutachten könne der Patientin oder dem Patienten schaden und zudem zum Arzthaftpflichtfall werden. Habe man zu einer zu begutachtenden Person engeren Kontakt, dann sollte man lieber die Finger von dem Vorgang lassen und sich als befangen erklären. „Dann werden Sie im Regelfall auch von diesem Gutachten entbunden.“
An einem Beispiel macht Dr. Konkel deutlich, dass es für Sachverständige empfehlenswert ist, an den eigenen Rechtsschutz zu denken. Ein Patient macht nach einem Unfall ein Schleudertrauma geltend. Das Gutachten bescheinigt jedoch einen degenerativen Bandscheibenschaden und die private Unfallversicherung zahlt nicht. „Hier gehen Leute durchaus mal vor Gericht und machen einen Vermögensschadensfall geltend.“ Dagegen sollten sich Sachverständige versichern, rät der Kollege. „War das ein Arbeitsunfall? War das kein Arbeitsunfall? Das kann alles für Sie irgendwann haftungsrelevant werden, wenn Sie nicht aufgepasst und das Ganze falsch gemacht haben.“ Gleiches gelte für Gutachten im Bereich Renten-, Kranken- und Haftpflichtversicherung.
Behandlung nach Facharztstandard
Das Arzthaftungsrecht gibt es seit einem Urteil des Reichsgerichts (RGSt 25, 375) im Jahr 1894. Grundsätzlich gilt, dass eine ärztliche Behandlung dem allgemein anerkannten fachlichen Facharztstandard entsprechen muss. Definiert ist dieser nach einem Artikel von Prof. Dr. Gert Carstensen 1989 im Deutschen Ärzteblatt als „Kombination aus wissenschaftlicher Erkenntnis, ärztlicher Erfahrung und Erprobung“ sowie professioneller Distanz. Ob die oder der behandelnde bzw. operierende Ärztin bzw. Arzt (z. B. Assistenzärztin/-arzt) eine formelle Facharztanerkennung hat, ist nicht maßgeblich. Entscheidend ist vielmehr, dass die Kenntnisse und Erfahrungen für die Behandlung ausreichen.
Schulungen helfen, die andere Seite besser zu verstehen
Der Hannoveraner Rechtsanwalt Dr. jur. Marcus Vogeler verweist ebenfalls auf die Trennung zwischen Medizin und Recht, aber auch auf die Bedeutung von Gutachten im Arzthaftungsverfahren. „Wir können kein ernsthaftes Verfahren entscheiden ohne Gutachten. Das sagt der Bundesgerichtshof.“
Eine Juristin bzw. ein Jurist dürfe sich in einem solchen Verfahren – bis auf sehr wenige Ausnahmen – aber kein medizinisches Fachwissen aus eigener Anschauung aneignen und niederschreiben. „Sie sind deshalb eine zentrale Figur im Arzthaftungsverfahren“, sagt der Fachanwalt für Medizinrecht in Richtung der anwesenden Ärztinnen und Ärzte.
Prozessbeteiligte würden wegen Nichtverstehens der anderen Seite oft aneinander vorbeireden, erzählt der Rechtsanwalt. Das führe zu einem interdisziplinären Diskurs. Schulungen zum Begutachtungsverfahren würden helfen, einander besser zu verstehen. Sie seien darüber hinaus beim Gewinnen von Nachwuchs für die Gutachtertätigkeit von Nutzen. Er sehe seit Jahren dieselben grauhaarigen Begutachtenden. „Wenn man da frischen Wind hineinbekäme, wäre das schön“, so Dr. Vogeler.
Der Medizinrechtler sieht in der Gutachtertätigkeit ebenso Vorteile für die ärztliche Praxis. „Wenn Sie einmal als Gutachter einen Behandlungsfall begutachtet und auf die Problematik geschaut haben, merken Sie plötzlich, welche Bedeutung das, was Sie im medizinischen Alltag machen, haben kann.“
Wie Dr. Vogeler erläutert, geht es im Arzthaftungsverfahren immer zuerst um die Frage, ob es einen Behandlungsfehler gab und ob von der oder dem Beschuldigten der medizinische Standard eingehalten wurde (siehe Kasten). Aber auch möglichen Aufklärungspflichtverletzungen wird in Arzthaftungsverfahren oft nachgegangen.
Eindringlich bemerkt der Rechtsanwalt: „Die Aufklärung hat stets und ausnahmslos mündlich zu erfolgen.“ Manchmal fühlten sich Ärztinnen und Ärzte „sehr verlockt durch ein wunderschönes Aufklärungsformular“. Bei der üblichen Heilbehandlung brauche es aber keine schriftliche Einwilligung, sondern immer das mündliche Gespräch. Die Unterschrift auf einem Aufklärungsbogen sei somit so gut wie nichts wert, sagt der Rechtsanwalt. Das habe der Bundesgerichtshof neulich nochmals bestätigt.
Dr. Vogeler rät übrigens auch dazu, die eigenen Versicherungen zu überprüfen: „Ich glaube, dass die meisten von Ihnen nicht wissen, ob sie für ihre gutachterliche Tätigkeit ausreichend versichert sind.“ In der Regel sei die Tätigkeit nicht über die Berufshaftpflicht versichert, sondern es sei ein Fall für die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Der Jurist verweist auf Streitsummen von bis zu 10 Mio. Euro bei Geburtsschaden oder einer Querschnittslähmung.
Er warnt: „Wenn Sie nur eine Versicherungssumme von 50.000 oder 100.000 Euro haben, haften Sie privat.“ Das sei dann eine absolute Katastrophe, denn „die Ärzteversorgung und alles, was Sie haben, wird auf das Minimum gepfändet – und Sie werden Ihres Lebens nicht mehr froh.“
Vorsicht bei niedrigen Versicherungssummen
Wie Dr. Vogeler berichtet, gibt es noch Ärztinnen und Ärzte mit Altverträgen und nicht ausreichenden Versicherungssummen. Die Haftungsvoraussetzungen seien allerdings sehr hoch, sagte er entwarnend. „Sie müssten nicht nur ein unrichtiges Gutachten erstatten. Was Sie geschrieben haben, müsste auch noch vorsätzlich und grob fahrlässig falsch, also nicht mehr vertretbar sein. Das wird kaum der Fall sein.“ Dass Sachverständige in einem Arzthaftungsverfahren im Prozessverlauf juristisch angegriffen werden, geschehe sehr selten, so Dr. Vogeler. Vorsorge sei aber immer besser als Nachsorge.
Quelle: Seminar der Kaiserin-Friedrich-Stiftung
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).




