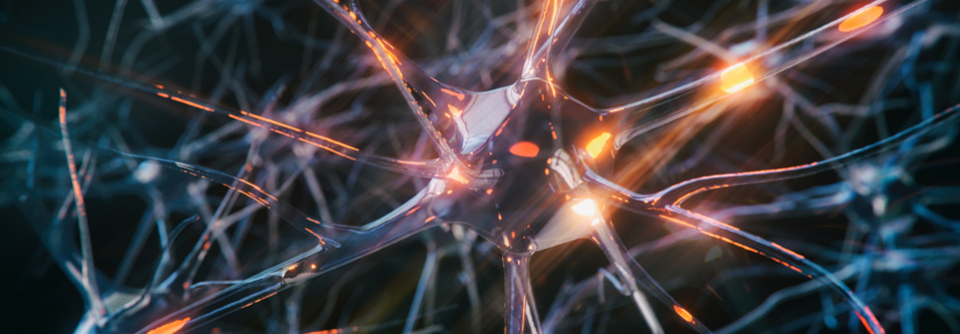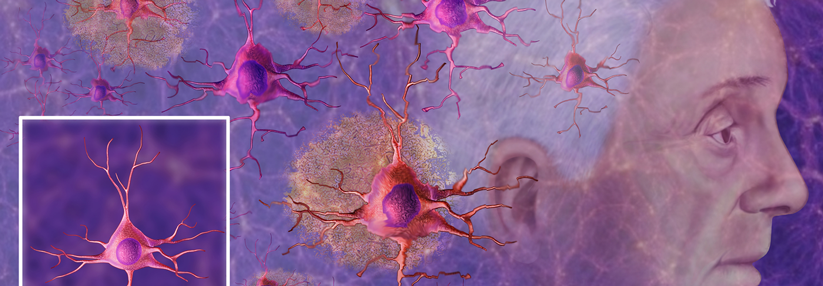Schützt inkretinbasierte Therapie auch das Gehirn?
 Trotz einiger Inkonsistenzen und Unklarheiten kommt das Autorenteam zu einer positiven Einschätzung.
© Tryfonov - stock.adobe.com
Trotz einiger Inkonsistenzen und Unklarheiten kommt das Autorenteam zu einer positiven Einschätzung.
© Tryfonov - stock.adobe.com
Agonisten des GLP1*-Rezeptors wie Exenatid, Dulaglutid, Liraglutid, Semaglutid und Lixisenatid sind derzeit für die Behandlung des Typ-2-Diabetes und der Adipositas zugelassen. Sie imitieren die Wirkung von endogenem GLP1, das als Reaktion auf die Aufnahme von Nahrung sezerniert wird und eine Schlüsselrolle in der Glukose-Homöostase spielt. Interessanterweise werden GLP1 und sein Rezeptor auch stark in ZNS-Regionen exprimiert, die mit Lernen und Gedächtnis assoziiert sind (z. B. im Hippocampus), schreibt ein Team um Dr. Riccardo De Giorgi von der University of Oxford. Auch im peripheren Nervensystem und in der Darm-Hirn-Achse finden sich Rezeptoren. Dieses Verteilungsmuster legt nahe, dass das GLP1-System einen direkten Einfluss auf neuronale Funktionen hat.
Tatsächlich haben In-vitro- und Tierstudien Hinweise auf eine neuroprotektive Wirkung ergeben. Erste unterstützende Evidenz kommt auch aus epidemiologischen Untersuchungen und klinischen Studien. Die Neuroprotektion könne dabei auf unterschiedlichen Mechanismen beruhen:
- Wiederherstellung der Energie-Homöostase in neuronalen Schaltkreisen
- Positive Beeinflussung der Neurogenese, Modulation der zerebralen Konnektivität
- Antiinflammatorische und antioxidative Wirkung
- Einfluss auf pathologische Proteinablagerungen
- Verbesserung der neurovaskulären und endothelialen Funktionen
In einer 2024 veröffentlichten schwedischen Registerstudie mit älteren Erwachsenen (n = 88.381) war die Nutzung von GLP1-RA über einen mittleren Beobachtungszeitraum von 4,3 Jahren mit einer um 20–30 % reduzierten Inzidenz von Demenzerkrankungen gegenüber DPP-4-Inhibitoren und Sulfonylharnstoffen verbunden. Im selben Jahr erschien eine Studie aus den USA, in der adipöse Patientinnen und Patienten unter GLP1-RA deutlich seltener Alzheimer (Relatives Risiko, RR, 0,63), eine Lewy-Body-Demenz (RR = 0,60) oder eine vaskuläre Demenz (RR = 0,44) entwickelten. Die Risikoreduktion für Morbus Parkinson (RR = 0,78) war zwar über alle Wirkstoffe nicht signifikant, unter Semaglutid jedoch zeigte sich ein signifikanter Schutz (RR = 0,57). Ein direkter Vergleich der verfügbaren Medikamente ist derzeit allerdings noch schwierig, da sich die Studiendesigns und Outcome-Parameter unterscheiden.
Bevor GLP1-RA zur Behandlung neurokognitiver Störungen im klinischen Alltag eingesetzt werden können, gibt es aber noch einige offene Fragen zu klären: Überwinden alle GLP1-RA die Blut-Hirn-Schranke? Mit welchen Biomarkern lassen sich Personen identifizieren, die auf die Therapie ansprechen werden? Und wie steht es überhaupt um die Sicherheit von GLP1-RA in der Langzeitanwendung?
Trotz einiger Inkonsistenzen und Unklarheiten kommt das Autorenteam zu einer positiven Einschätzung. Bis zum routinemäßigen klinischen Einsatz von GLP1-RA bei Menschen mit kognitiven Störungen dürfte jedoch noch einige Zeit ins Land gehen.
* Glucagon-Like Peptide 1
Quelle: De Giorgi R et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2025; DOI: 10.1136/jnnp 2024-335593
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).