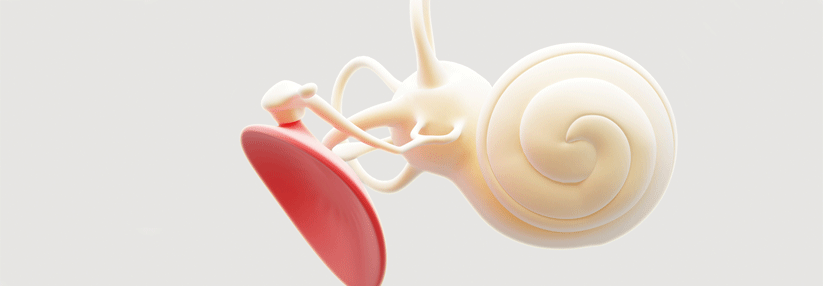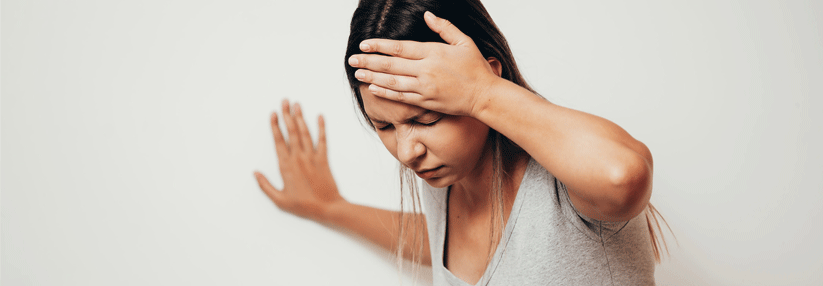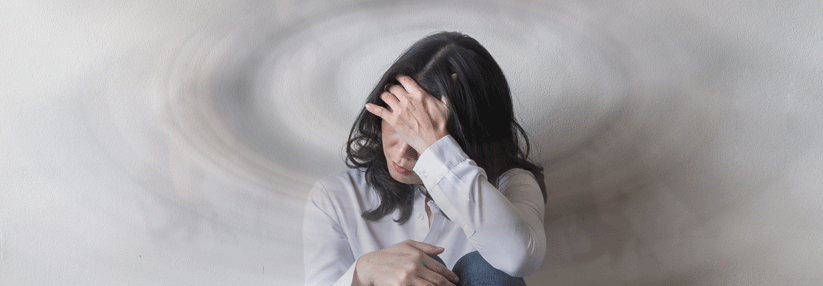
Therapie und Prophylaxe orientieren sich am Klassiker
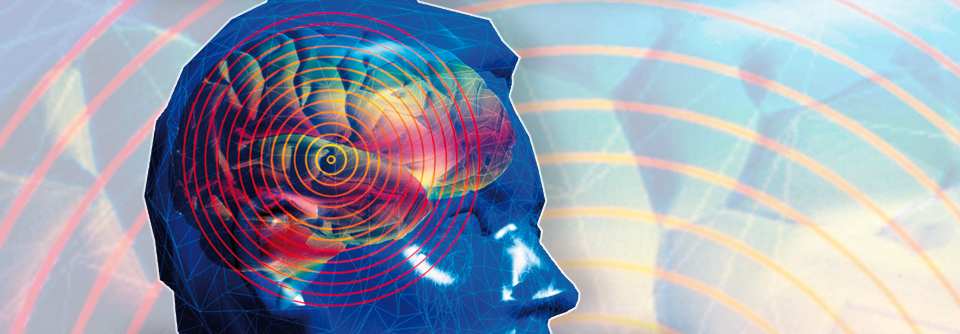 Bei Schwindel plus typischen Migränesymptomen ist die Diagnose vestibuläre Migräne einfach.
© Science Photo Library/Pasieka, Alfred
Bei Schwindel plus typischen Migränesymptomen ist die Diagnose vestibuläre Migräne einfach.
© Science Photo Library/Pasieka, Alfred
Wie die klassische Migräne tritt auch die Kombination mit Schwindel überwiegend bei Frauen auf. Die typische Klientel sind junge Erwachsene, aber selbst Kinder bleiben nicht verschont. Spezielle Biomarker für die Erkrankung konnten noch nicht identifiziert werden. Deshalb basiert die klinische Diagnose in erster Linie auf der Anamnese. Für den sicheren Nachweis einer vestibulären Migräne müssen vier Kriterien erfüllt sein. Für eine wahrscheinliche Diagnose genügen drei davon, heißt es in der S2k-Leitlinie der deutschen Fachgesellschaften für Neurologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Audiologie.
Die Kriterien der vestibulären Migräne
- mindestens fünf Episoden mit vestibulären Symptomen (moderat bis stark ausgeprägt), die über 5 Minuten bis 72 Stunden anhalten
- aktive oder frühere Migräne (mit oder ohne Aura) nach den Kriterien der ICHD (International Classification of Headache Disorders)
- mindestens ein Migränesymptom während ≥ 50 % der vestibulären Episoden:
- Kopfschmerzen mit mindestens zwei der folgenden Merkmale: einseitige Lokalisation, pulsierender Charakter, mittlere bis starke Schmerzintensität, Verstärkung durch körperliche Routineaktivitäten
- Photophobie und Phonophobie
- visuelle Aura
- Symptomatik nicht auf andere vestibuläre oder ICHD-Diagnosen zurückzuführen
- mindestens fünf Episoden mit moderaten bis starken vestibulären Symptomen, die über 5 Minuten bis 72 Stunden anhalten.
- positive Migräneanamnese oder Migränesymptome (s.o.) während der Attacke
- Symptomatik nicht auf andere vestibuläre oder ICHD-Diagnosen zurückzuführen
Während der Attacke oft pathologischer Nystagmus
Vielfach finden sich migränetypische Trigger wie Schlafentzug und Menstruation. Auch ein starkes Ruhebedürfnis in oder nach der Attacke spricht für die Diagnose. Cochleäre Beschwerden (ein- oder beidseitig) manifestieren sich bei der VM wesentlich seltener, sind überwiegend reversibel und leichter als beim M. Menière. Letzterer wird dagegen in weniger als 10 % der Fälle von Kopfschmerzen begleitet. Bei Problemen mit der Differenzierung spricht Lärmempfindlichkeit eher für die Innenohrerkrankung und Lichtscheu eher für die Cephalgie. Im Gegensatz zu anderen Migräneformen und dem Morbus Menière lassen sich bei rund 60 % der VM-Patienten im Intervall (geringfügige) Störungen der zentralen Okulomotorik nachweisen. Diese manifestieren sich mit einem Blickrichtungs-, Spontan- oder zentralen Lagenystagmus bzw. einer sakkadierten Blickfolge. Auch während der Anfälle zeigen mehr als zwei Drittel der VM-Patienten einen pathologischen Nystagmus. Zudem klagen viele über Ohrdruck (oft bilateral), Tinnitus und eine leichte Minderung des Hörvermögens. Die gleichzeitig auftretende Bewegungsempfindlichkeit wird als Folge einer neuronalen sensorischen Übererregbarkeit gedeutet. Die vestibuläre Migräne kann Schwindelepisoden jeglicher Dauer auslösen. Deshalb wird sie neben dem M. Menière auch leicht mit transitorisch ischämischen Attacken sowie Vestibularisparoxysmie und episodischer Ataxie Typ 2 verwechselt. Mitunter gelingt die korrekte Einordnung nur mit einer probatorischen Therapie. Zur sicheren Differenzierung von vestibulärer Migräne und peripher verursachtem Schwindel (in erster Linie M. Menière) empfehlen die Leitlinienautoren, alle Patienten mit episodischen vestibulären Symptomen ausführlich nach sämtlichen Ohrsymptomen zu fragen. Auch potenzielle Hinweise auf eine Migräne sind sorgfältig zu eruieren – zumindest sollte der Patient einen validierten Fragebogen ausfüllen. Bewährt haben sich Migraine Disability Assessment (MIDAS), Dizziness Handicap Inventory (DHI) und Activity-Specific Balance Confidence Scale (ABC-Scale), die alle in einer deutschen Version vorliegen. Außerdem raten die Verfasser, die Diagnose mit entsprechenden Hör- und Gleichgewichtstests abzusichern. Zur Behandlung der vestibulären Migräne gibt es bisher nur wenige kontrollierte Studien. In Akuttherapie und Prophylaxe scheinen sich die gleichen Strategien zu bewähren wie bei der entsprechenden Cephalgie ohne Aura.Betablocker in der Prophylaxe am effektivsten
Bei längeren Attacken wird die möglichst frühzeitige Anwendung eines nicht-steroidalen Antirheumatikums empfohlen (z.B. Ibuprofen oder Diclofenac als Suppositorium) oder Acetylsalicylsäure als Brausetablette. Dabei kann die Kombination mit einem Antiemetikum (z.B. Dimenhydrinat, Metoclopramid, Domperidon) hilfreich sein. In der Prophylaxe zeigen sich Betablocker wie Metoprolol und Propranolol als besonders wirksam. Mit nachlassender Effektivität folgen Antiepileptika (Topiramat, Valproinsäure), Antidepressiva (Amitriptylin), Kalziumantagonisten (Flunarizin), Magnesium und Riboflavin. Neben der medikamentösen Therapie hat sich ein vestibuläres Gleichgewichtstraining bewährt.Quelle: S2k-Leitlinie „Vestibuläre Funktionsstörungen“, AWMF-Register-Nr. 017/078, www.awmf.org
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).