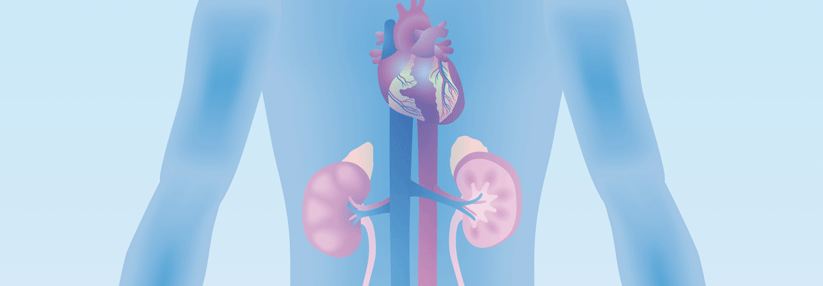
Thiaziddiuretika: Wirksam, aber risikobehaftet
 Ob zur antihypertensiven Therapie, Ödemmobilisierung oder Behandlung einer Hyperkalzurie, die Anwendungsbereiche der Thiazide sind vielfältig.
© MQ-Illustrations - stock.adobe.com
Ob zur antihypertensiven Therapie, Ödemmobilisierung oder Behandlung einer Hyperkalzurie, die Anwendungsbereiche der Thiazide sind vielfältig.
© MQ-Illustrations - stock.adobe.com
Ob zur antihypertensiven Therapie, Ödemmobilisierung oder Behandlung einer Hyperkalzurie, die Anwendungsbereiche der Thiazide sind vielfältig. Doch bei der Gabe ist Obacht geboten, denn die harntreibenden Medikamente gehen mit einigen Risiken einher – von Elektrolytstörungen bis hin zu Hauttumoren.
Thiaziddiuretika haben bereits seit über 60 Jahren in der Medizin ihren Platz – mit Chlorothiazid als einer der ersten Wirkstoffe. Genutzt werden die harntreibenden Substanzen vor allem zur Behandlung der arteriellen Hypertonie und der chronischen Herzinsuffizienz. Doch sollte man bei der antihypertensiven Therapie eher auf Thiazide oder auf thiazidartige Diuretika setzen? Beide unterscheiden sich in ihrer chemischen Struktur und somit auch in ihren pharmakologischen Eigenschaften, erklärte Prof. Dr. Martin Kimmel vom Alb-Fils Klinikum, Göppingen.
Sie besitzen jeweils eine Sulfamoyl- sowie eine Halogengruppe und einen Benzothiazidinring. Letzterer liegt bei den thiazidähnlichen Diuretika in abgewandelter Form vor, was sich klinisch bemerkbar macht. So ist die Halbwertszeit von Thiaziden wie Hydrochlorothiazid (2–15 h, im Durchschnitt 6 h) kürzer als von den verwandten Vertretern, darunter Chlortalidon (40–60 h) und Indapamid (14 h).
In der Vergangenheit hegte man die Vermutung, dass Chlortalidon einen besseren antihypertensiven Effekt habe als Hydrochlorothiazid, merkte Prof. Kimmel an, doch eine Studie aus den USA scheint dem zu widersprechen. In dieser zeigte sich unter Hydrochlorothiazid und Chlortalidon kein signifikanter Unterschied hinsichtlich Blutdrucksenkung und kardiovaskulärer Ereignisse wie Myokardinfarkt, Schlaganfall oder Herzinsuffizienz. Die Forschenden achteten insbesondere auf adäquate Äquivalenzdosen, begründete der Referent diese Ergebnisse. Chlortalidon – mit einer längeren Halbwertszeit – ging allerdings häufiger mit einer Hypokaliämie einher (Inzidenz 6,0 % vs. 4,4 %).
Ein wichtiger Aspekt bei der antihypertensiven Therapie ist das Vorliegen einer chronischen Nierenerkrankung. Bei eingeschränkter Nierenfunktion ist eine höhere Dosis nötig. Thiazide müssen tubulär filtriert werden, um dann den Transporter zu blockieren. Je schlechter die Nierenfunktion ist, desto mehr braucht man von der Substanz, erklärte Prof. Dr. Mark Alscher vom Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart. Allerdings gibt es auch eine Höchstdosis, ab der sich der diuretische Effekt nicht mehr maximieren lässt. Doch auch wenn man die Wirkstoffmenge bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung steigert, ist es unwahrscheinlich, dass sie genauso gut auf das Diuretikum ansprechen wie gesunde Menschen.
Im Falle einer schweren Nierenfunktionsstörung mit einer GFR < 30 ml ist eine Behandlung mit Thiaziden laut vielen Leitlinien kontraindiziert, erläuterte Prof. Kimmel. Eine Arbeit aus den USA zeigte jedoch einen deutlichen blutdrucksenkenden Effekt unter Chlortalidon gegenüber Placebo bei Menschen mit einer Niereninsuffizienz im Stadium 4. Einschränkend merkte der Referent an, dass in der Untersuchung der Wirkstoff teils sehr hoch dosiert war (auftitrierte Maximaldosis von 50 mg/d).
Ein wichtiges pharmakologisches Konzept bei der dekompensierten Herzinsuffizienz ist die sequenzielle Nephronblockade. Dabei werden zwei verschiedene Diuretika mit unterschiedlichen Wirkorten kombiniert, häufig ein Thiazid mit einem Schleifendiuretikum. Eine Studie aus Spanien konnte beispielsweise zeigen, dass bei Patientinnen und Patienten mit einer Herzinsuffizienz, bei denen die Therapie mit einem Schleifendiuretikum durch ein Thiazid ergänzt wurde, sich das Gewicht stärker reduzieren ließ als unter der Monobehandlung. Unter der dualen Therapie kam es allerdings häufiger zu einer eingeschränkten Nierenfunktion. Hypokaliämien traten bei beiden Patientenkollektiven ähnlich häufig auf.
Außer Hypokaliämien drohen unter Thiaziden auch Hyponatriämien. Dafür haben insbesondere ältere Frauen ein erhöhtes Risiko, betonte Prof. Kimmel. Neben den Elektrolytstörung gibt es aber noch weitere Risiken. So steigt unter Thiaziden die Gefahr für Hauttumoren. Viele Studien konnten einen Zusammenhang zwischen Hydrochlorothiazid und Melanomen sowie Basalzell- und Plattenepitelkarzinomen zeigen. Dabei handelt sich um einen kumulativen Effekt über die Zeit und Dosis.
Thiazide auf fremdem Gebiet
Ein Anwendungsgebiet für Thiazide, das sich nicht direkt erschließt, ist die Gabe beim Diabetes insipidus. Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch Polyurie. Thiazide haben die Besonderheit, dass unter ihnen das tubuloglomeruläre Feedback erhalten bleibt und die GFR reduziert wird, was ihren Einsatz begründet.
Thiazide senken auch die Kalziumausscheidung, betonte Prof. Kimmel. Ihre Gabe wird daher auch zur Metaphylaxe von Nierensteinen bei Hyperkalzurie diskutiert. Kürzlich veröffentlichte Studienergebnisse waren aber eher enttäuschend.
Immer wieder werde diskutiert, ob es sich dabei um einen Klasseneffekt handle. Wahrscheinlich ja, so Prof. Kimmel, denn Thiazide und thiazidähnliche Diuretika sind photosensibilisierend. Zu den Thiazidanaloga liegen jedoch deutlich weniger Untersuchungen vor. Eine Auswertung zu Indapamid konnte keinen Zusammenhang mit nichtmelanozytärem Hautkrebs herstellen – allerdings war die Datenmenge gering, wie der Referent einschränkend anmerkte.
Thiazide begünstigen auch Gichtanfälle, denn sie werden über den gleichen organischen Anionentransporter sezerniert wie die Harnsäure. Somit konkurrieren beide Stoffe um den Transporter. Der Harnsäurespiegel im Blut steigt, was zu einer Hyperurikämie führen kann. Angestoßen durch die Volumenkontraktion kann es unter Diuretika außerdem zu einer metabolischen Alkalose kommen.
Dennoch: Thiazide seien langfristig wirklich gute Substanzen, fasst Prof. Alscher abschließend zusammen. Gewisse Einschränkungen beispielsweise in Abhängigkeit der glomerulären Filtrationsrate müsse man allerdings bei ihrem Einsatz im Blick haben.
*Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
Quelle: Kongress der DGIM
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).
