
Vom Antikörper bis Zelltherapie: Moderne Optionen verlängern Leben
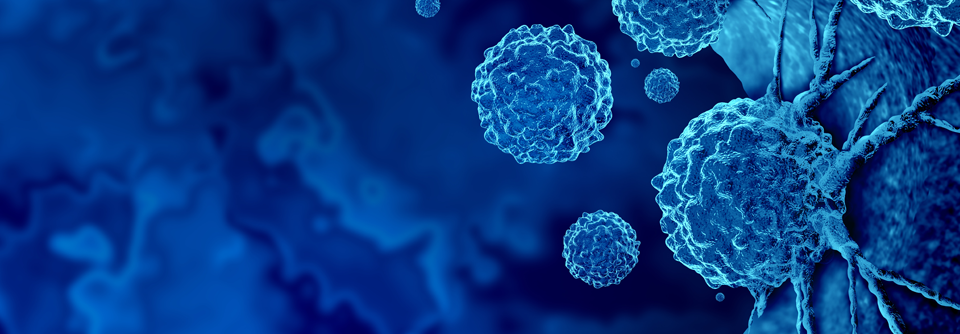 Betroffene mit metastasiertem Melanom profitieren von immunonkologischen Strategien.
© freshidea – stock.adobe.com
Betroffene mit metastasiertem Melanom profitieren von immunonkologischen Strategien.
© freshidea – stock.adobe.com
Jahr für Jahr sterben in Deutschland etwa 3.000 Menschen am fortgeschrittenen Melanom. Dank moderner Systemtherapien hat sich die Prognose aber signifikant verbessert. Was ist heute schon möglich und wohin entwickelt sich die Forschung?
Aus der Behandlung des nichtresezierbaren fortgeschrittenen Melanoms heutzutage fast nicht mehr wegzudenken sind die Immuncheckpoint-Inhibitoren: Die PD1-Antikörper Nivolumab und Pembrolizumab können „mono“ eingesetzt werden. Der CTLA4*-Antikörper Ipilimumab eignet sich allein oder in Kombination mit Nivolumab. Der LAG**-3-Antikörper Relatlimab ist nur in Kombination mit Nivolumab zur Erstlinienbehandlung zugelassen. Sie stand aber zum Zeitpunkt der Publikation in Deutschland weiterhin nicht zur Verfügung wegen unklarer Kostenerstattung, schreibt das Autorenteam um Dr. Georg Lodde von der Dermatologie der Universitätsklinik Essen. Außerdem gibt es mit den BRAF/MEK-Inhibitoren die Möglichkeit zur zielgerichteten Therapie (siehe Kasten).
Zielgerichtet zum Ziel
Etwa vier von zehn Melanomen weisen eine BRAF-V600-Mutation auf. Bei diesen Patienten können neben den Immuncheckpointinhibitoren auch BRAF/MEK-Inhibitoren eingesetzt werden:
- Dabrafenib und Trametinib
- Vemurafenib und Cobimetinib
- Encorafenib und Binimetinib
Die einzelnen Kombinationen unterscheiden sich zwar in puncto Nebenwirkungsprofil und Kinetik, die Ansprechraten liegen allerdings alle bei etwa 70 % und das Ansprechen ist insgesamt schnell. Das mediane progressionsfreie Überleben beträgt 11–15 Monate und das Gesamtüberleben (7 Jahre) liegt bei 27 %. Zielgerichtete Therapien eignen sich vor allem bei hoher Tumorlast und schneller Tumordynamik. Stellt man die BRAF/MEK-Inhibition der Checkpointinhibition (ICI) gegenüber, zeigte sich laut einer Studie ein signifikant verlängertes Überleben für die Erstlinientherapie mit letzterer (Hazard Ratio 0,6). Die DREAMseq-Studie wies zudem nach, dass eine kombinierte ICI mit nachfolgender BRAF/MEK-Inhibition hinsichtlich des Progresses der umgekehrten Abfolge überlegen ist (ohne vorherige adjuvante Systemtherapie).
Mit der kombinierten CTLA4- und PD1-Inhibition lässt sich beim metastasierten Melanom eine langfristige Tumorkontrolle erreichen, ebenso mit der Anti-PD1-Monotherapie. Zehnjahresdaten aus Studien ergaben für die CTLA4/PD1-Blockade ein medianes Gesamtüberleben von 73 Monaten. Mit PD1-Hemmern erreichte man im Mittel 37 Monate, das melanomspezifische Survival lag bei 50 Monaten. Erkauft wird der Erfolg oft mit vermehrten schweren Nebenwirkungen (Grad 3–4), die unter der Kombination deutlich häufiger vorkommen im Vergleich zur Monotherapie (63 % vs. 25 %).
Langzeitüberlebende haben eine vergleichbare Lebensqualität wie die Allgemeinbevölkerung. Surrogatmarker auf ein sehr gutes Ansprechen sind eine Tumorlastreduktion um ≥ 80 % und ein progressionsfreies Überleben nach drei Jahren. Ein großes Problem bilden allerdings Therapieresistenzen, sie können primär vorhanden sein oder sich später bilden. Unter der CTLA4/PD1-Inhibition erleben etwa 60 % der Behandelten einen Wirkverlust.
Neue Pharmaka könnten die Lage verbessern. Ein möglicher Ansatzpunkt ist der kürzlich entdeckte Immuncheckpoint IGSF8, der natürliche Killerzellen und dendritische Zellen hemmt. Bei ersten Untersuchungen als therapeutischer Ansatzpunkt gelang eine Ansprechrate von 17 % – eingeschlossen waren Menschen mit metastasiertem Melanom, die unter der üblichen Checkpointinhibition progredient waren. Weitere Möglichkeiten bieten sich, wenn PD1-Hemmer mit anderen Partnern kombiniert werden. Derzeit möglich bzw. untersucht werden das onkolytische Virus RP1, der Multikinase-Hemmer Lenvatinib oder ein Hemmer des Wnt/β-Catenin-Signalwegs. Auf das Virus und den Kinasehemmer sprachen etwa 24–30 % der Behandelten an, das mediane Gesamtüberleben für die Kinasen/PD1-Hemmung lag bei 14 Monaten.
Vielversprechend sind auch zellbasierte Therapien, z. B. mit tumor-infiltrierenden T-Lymphozyten (TIL). Aus dem Melanomgewebe gewonnene TIL werden vermehrt und nach einer lymphodepletierenden Chemotherapie wieder infundiert. Aktuelle Daten ergaben eine Ansprechrate von 32 %. Von den Personen, die dieses Ziel erreichten, überlebten 47 % vier Jahre. Derzeit probiert man auch diese Therapie mit der PD1-Inhibition noch zu ergänzen. Ein dazu analoger Ansatz ist die Verwendung von CAR-T-Zellen, bei denen es sich aber um in Bezug auf die Tumorerkennung genetisch modifizierte T-Zellen handelt.
Gegenstand aktueller Forschung sind bispezifische Fusionsproteine (-fusp), die an zwei Bindungsstellen – Tumorantigen und den CD3-Korezeptor der T-Zellen – wirken. Ein bereits existierendes Medikament aus dieser Kategorie ist Tebentafusp. Zugelassen ist es bereits für das fortgeschrittene uveale Melanom. Derzeit rekrutiert eine Phase-2/3-Studie Patientinnen und Patienten mit kutanem Tumor. Ein weiteres vielversprechendes Zielmolekül wird PRAME*** abgekürzt. Das bispezifische Fusionsprotein Brenetafusp hat in einer Phase-1-Studie eine Krankheitskontrollrate von 32 % bei PRAME-positivem Hautmelanom erzielt – bei guter Verträglichkeit.
Auch mRNA-Vakzine könnten sich zu einer zukünftigen Standardtherapie entwickeln: Eine Phase-2-Studie prüft Wirkung, Verträglichkeit und Sicherheit von BNT111 im Zusammenwirken mit Cemiplimab bei PD1-Therapieresistenz. Es gibt auch Ansätze tumorindividuelle Vakzine einzusetzen.
Ein hohes Rückfallrisiko tragen Personen mit vollresezierbarem Melanom ab Stadium IIb. Dreijahresauswertungen der adjuvanten PD1-Therapie ergaben bereits im Stadium IIB/C eine längere Rezidivfreiheit. Langzeitdaten zeigen auch für das Stadium III/IV ein verlängertes progressionsfreies Überleben unter der adjuvanten Behandlung (sowohl für die Anti-PD1-Ansätze als auch für die BRAF/MEK-Inhibition).
Für bestimmte Subgruppen ist die neoadjuvante bzw. perioperative Therapie möglicherweise eine gute Alternative zum konventionellen adjuvanten Vorgehen. Dabei erhalten Patientinnen und Patienten im Stadium III mit makroskopisch erkennbarer Erkrankung vor der Metastasenresektion eine Systemtherapie mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor. Laut den bisherigen Untersuchungen konnte damit das progressionsfreie Überleben innerhalb der nächsten zwölf Monate von 57 % auf 84 % gesteigert werden. Die neoadjuvante Option wird derzeit erst im Rahmen klinischer Studien angeboten.
*cytotoxic T-Lymphocyte-associated Protein 4
**Lymphozyten-Aktivierungsgen
*** preferentially expressed antigen in melanoma
Quelle: Lodde G et al. Dtsch Med Wochenschr 2025; doi: 10.1055/a-2231-7157
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).



