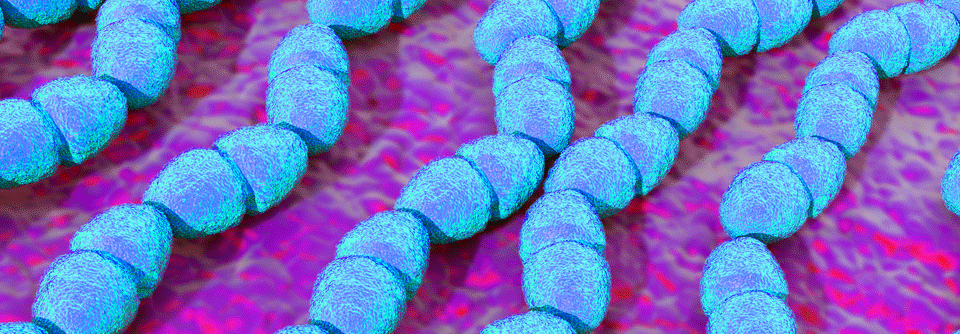Warum die Stammzelltransplantation bei refraktärem Morbus Crohn doch Hoffnung gibt
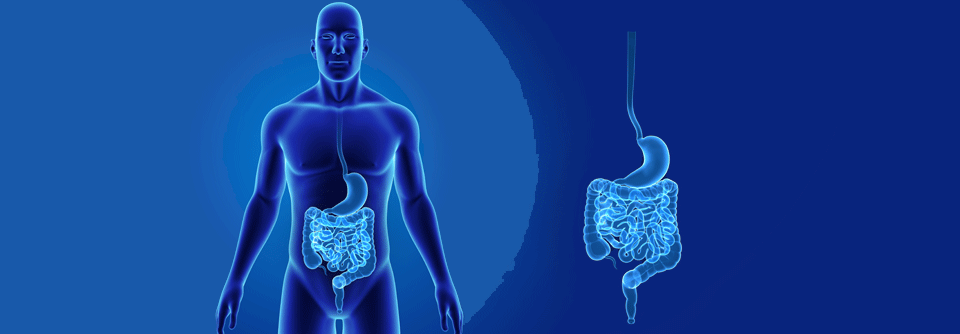 Die Stammzelltherapie bei refraktärem Morbus Crohn hat einen schlechten Ruf.
© 7activestudio - stock.adobe.com
Die Stammzelltherapie bei refraktärem Morbus Crohn hat einen schlechten Ruf.
© 7activestudio - stock.adobe.com
Versagen bei Morbus Crohn die Therapien, sind die weiteren Möglichkeiten überschaubar: Man kann off label behandeln oder die Betroffenen in Studien einschließen. Doch bei vielen von ihnen funktioniert keine dieser Strategien, also wartet man auf neue Zulassungen, erklärte Prof. Dr. Louis Cohen von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York.
In seinem Vortrag rückte er die viel diskutierte autologe hämatopoetische Stammzelltransplantation in ein neues Licht. Bei dieser werden die deregulierten Immunzellen via Depletion eliminiert und zuvor extrahierte hämatopoetische Stammzellen zugeführt. Aufgrund möglicher Nebenwirkungen der Konditionierung hatte die Behandlung bislang keinen guten Ruf. Mitunter wurde auch die Wirksamkeit infrage gestellt (s. Kasten). Prof. Cohen zufolge könnte sich die Stammzelltherapie jedoch zu einem Standard entwickeln. In einer Studie wollen er und sein Team an vier Zentren ihre Wirkung und Sicherheit über einen Zeitraum von zehn Jahren untersuchen. Zwischenergebnisse zeigten sich bereits vielversprechend.
In die Interimsanalyse schloss das Team 68 Personen (medianes Alter 33 Jahre) mit refraktärem Crohn und einer Krankheitsdauer von etwa 15 Jahren ein. Medikamente wie TNFa-, Integrin-, Interleukin- und JAK-Inhibitoren sowie Zytostatika (Methotrexat, Azathioprin, Mercaptopurin) hatten bei den Teilnehmenden nichts bewirkt. Alle erhielten eine vorbereitende Therapie mit Cyclophosphamid und Antithymozytenglobulin. Die Auswertung erfolgte nach median zwei Jahren.
Sowohl der klinische als auch der vereinfachte endoskopische Aktivitätsindex bei Crohn (CDAI bzw. SES-CD) verbesserte sich zum Follow-up. Bei 72 % der Patientinnen und Patienten ließ sich eine klinische und bei 75 % eine endoskopische Verbesserung feststellen.
Lebensqualität steigt nach Therapie an
Die Therapie kam zudem gut an, berichtete Prof. Cohen. In einem kleinen Patientkollektiv (n = 10) am Mount Sinai stiegen Lebensqualität und soziale Aktivität der Teilnehmenden. Gleichzeitig gingen Schmerzinterferenz und depressive Symptome zurück.
Insgesamt traten keine langfristigen Nebenwirkungen wie Nierenversagen oder Malignitäten auf. Zudem gab es weder Hospitalisierungs- noch Todesfälle. Bei keinem der Teilnehmenden kam es bisher zum Darmversagen. Es wurden sieben Operationen im Zusammenhang mit der Erkrankung durchgeführt, darunter allerdings zwei Stoma-Rückverlegungen.
Prof. Cohen und seinem Team zufolge sei die Stammzelltransplantation mit Cyclophosphamid und Antithymozytenglobulin klinisch effektiv. Sie biete die Möglichkeit einer kurz- sowie langzeitigen Remission mit einer Wiederaufnahme fortgeschrittener Therapien, erklärte Prof. Cohen abschließend.
Quelle: Kongressbericht 20th Congress of ECCO*
*European Crohn‘s and Colitis Organisation
Imageproblem der Stammzelltransplantation
Warum ist die Stammzelltherapie kein Standard? Prof. Cohen zufolge tragen vor allem zwei Studien Schuld daran. Zum einen litt die ASTIC-Studie unter dem Abstract-Problem: Viele Menschen lesen nur das Abstract, erklärte der Referent. Und das Fazit der Studie war, dass das Hauptziel nicht erreicht werden konnte und die Ergebnisse somit nicht für eine breite Anwendung sprechen. Der primäre kombinierte Endpunkt sei jedoch viel zu hoch angesetzt und nicht realistisch für ein Patientenkollektiv mit refraktärem Crohn gewesen, betonte der Kollege. Ziel war eine anhaltende Remission zwölf Monate nach der Transplantation, d.h.
- CDAI < 150 (klinische Remission),
- kein endoskopischer oder radiologischer Nachweis einer aktiven (erosiven) Erkrankung sowie
- keine aktive Behandlung mit Kortikosteroiden oder Biologika in den letzten drei Monaten.
Tatsächlich zeige die Stammzelltransplantation in ASTIC einen außergewöhnlichen Nutzen, so Prof. Cohen. Eine endoskopische Verbesserung wurde bei fast 90 % der Teilnehmenden erzielt, sie übertraf somit die klinische Ansprechrate. Eine solche Verzerrung sei auf bestehende Darmläsionen zurückzuführen, führte der Referent fort.
Ein weiterer Aspekt der Diskussion ist die Sicherheit der Therapie. In ASTIC ließen sich vor allem kurzzeitige Komplikationen feststellen, insbesondere virale Infektionen. Allerdings gab es einen Todesfall. Letztendlich müsse man das Risiko der Behandlung gegenüber der Gefahr des Nichtstuns abwägen, betonte der Referent.
In der ASTIC-lite-Studie wurde ein als sicherer geltendes Konditionierungsschema mit Cyclophosphamid und Fludarabin untersucht. Dieses findet bereits Anwendung in der Krebstherapie und ermöglicht den Einsatz einer reduzierten Cyclophosphamiddosis. Unter der Behandlung kam es aber unerwartet zu zwei Todesfällen und bei drei Personen zu Nierenversagen aufgrund einer thrombotischen Mikroangiopathie.
Solche Komplikationen habe man bei der vorherigen Konditionierung mit Antithymozytenglobulin nicht beobachtet, merkte der Referent einschränkend an.
Man könne nicht davon ausgehen, dass eine Behandlung, die als Krebstherapie sicher und wirksam ist, sich auch auf Morbus Crohn komplett übertragen ließe. So ist bekannt, dass Fludarabin dem Endothel schadet. Das spiele bei den Komplikationen wahrscheinlich eine Rolle, erklärte Prof. Cohen. Er vermutet, dass bei Patientinnen und Patienten mit einer Entzündungsaktivität über 20 Jahre hinweg möglicherweise ein gewisser Priming-Effekt zugrunde liegt. Es brauche daher spezielle Protokolle, so sein Fazit.
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).