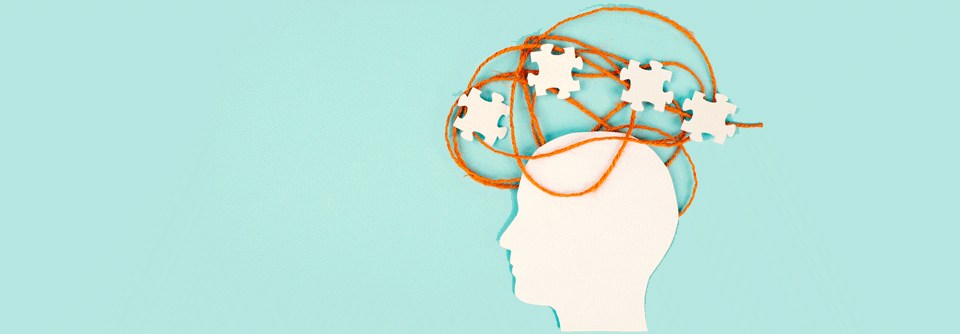Wenn die Komorbidität übersehen wird, steigen die Risiken
 Die Folgen des Syndroms werden der Expertin zufolge oft unterschätzt.
© peopleimages.com - stock.adobe.com
Die Folgen des Syndroms werden der Expertin zufolge oft unterschätzt.
© peopleimages.com - stock.adobe.com
Wie häufig die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssstörung (ADHS) bei Erwachsenen auftritt, hängt stark von den verwendeten Diagnosekriterien ab. Müssen die Symptome vor dem zwölften Lebensjahr begonnen haben, wie in ICD-11 und DSM-5 gefordert, liegt die Prävalenz bei etwa 2,5 %. Bei jungen Erwachsenen ist sie etwas höher, sinkt aber mit dem Alter. Selbst bei Seniorinnen und Senioren beträgt sie noch mindestens 1 %, erklärte Prof. Dr. Alexandra Philipsen, Universitätsklinikum Bonn. Ohne das Kriterium „Beginn in der Kindheit“ steigt die Prävalenz bei Erwachsenen sogar auf rund 6 %.
Dass sich eine im Kindesalter bestehende ADHS nur selten verwächst, zeigen die Ergebnisse der MTA*-Langzeitstudie: 90 % der Betroffenen mit pädiatrischer ADHS wiesen im jungen Erwachsenenalter noch Symptome auf – auch wenn sie nicht immer die vollen diagnostischen Kriterien erfüllen. Nur ca. 10 % der Patientinnen und Patienten erlebten mit dem Übergang ins Erwachsenenalter eine stabile Remission. Bei den meisten (60–70 %) zeigte sich ein fluktuierender Verlauf. „Die Symptomatik tritt dann je nach den Lebensumständen mehr oder weniger stark zutage“, erklärte Prof. Philipsen.
Die Folgen des Syndroms werden der Expertin zufolge oft unterschätzt. So ist die Mortalität der Betroffenen in jedem Lebensalter signifikant erhöht. Bei Frauen beträgt die mittlere Lebenszeitverkürzung 8,6 Jahre, Männer verlieren durchschnittlich 6,8 Lebensjahre.
Neben der Desorganisation im Alltag zählt eine gestörte Emotionsregulation zu den zentralen klinischen Merkmalen im Erwachsenenalter. 70 % der Patientinnen und Patienten erleben ihre Gefühle als schwer kontrollierbar oder oft übermäßig intensiv. Eine emotionale Dysregulation haben rund 40 % der Betroffenen. In Kombination mit der typischen Impulsivität sollte ADHS deshalb unbedingt als Differenzialdiagnose zur Borderline-Persönlichkeitsstörung in Betracht kommen, so Prof. Philipsen. Tatsächlich treten beide Erkrankungen oft gemeinsam auf.
Gut dokumentiert ist auch die Verbindung zu Substanzmissbrauch. Etwa 21 % der Suchtkranken erfüllen die Kriterien für ADHS, und unter den Erwachsenen mit ADHS sind rund 40 % alkoholabhängig. Bei Personen mit einem Substanzmissbrauch sollte daher ebenfalls standardmäßig ein Screening auf ADHS erfolgen.
Unerkanntes Problem bei Obdachlosigkeit und Sucht
Menschen mit ADHS und Opioidmissbrauch brechen einer Studie von 2024 zufolge eine Entzugsbehandlung fast doppelt so häufig ab wie Betroffene ohne ADHS. Schwer opiatabhängige Patientinnen und Patienten, die oft aus der Obdachlosigkeit oder anderen prekären Lebensverhältnissen an die Universitätsklinik kommen, sind Prof. Philipsen zufolge meist stark stigmatisiert. Ihre Erfahrung zeige, dass es gerade für diese Menschen extrem hilfreich sein kann, wenn eine komorbide ADHS erkannt und professionell behandelt wird.
Auch beim Vorliegen einer affektiven Störung kann sich die weitergehende Diagnostik lohnen. Einer Metaanalyse aus dem Jahr 2021 zufolge ist das ADHS-Risiko bei Menschen mit klinischer Depression dreifach erhöht, bei bipolar Erkrankten sogar fünffach. Wenn jemand mit einer akuten Manie in die Klinik komme, denke man selten an ADHS, so Prof. Philipsen. Diese Abklärung sei jedoch wichtig, denn mit komorbider ADHS sind affektiv Erkrankte schwerer beeinträchtigt und es erfolgen häufiger Suizidversuche.
Erhöhte Prävalenz für kardiovaskuläre Krankheiten
Viele somatische Erkrankungen zeigen ebenfalls Zusammenhänge mit ADHS, etwa Schilddrüsenerkrankungen, hormonelle Beschwerden wie das prämenstruelle Syndrom und perimenopausale Symptome, Autoimmunerkrankungen, Adipositas und Demenzen. Eine schwedische Registerstudie von 2022 fand bei Erwachsenen mit ADHS eine um 50 % erhöhte Prävalenz für kardiovaskuläre Erkrankungen insgesamt.
Die Veranlagung spielt bei ADHS eine zentrale Rolle. Etwa 70–80 % der Unterschiede im Auftreten lassen sich auf genetische Faktoren zurückführen – ein Wert, der nur bei wenigen psychischen Störungen erreicht wird. Viele Risikoloci sind mit dem dopaminergen System und präfrontalen Strukturen assoziiert, einige haben auch Verbindungen zum Cholesterinstoffwechsel und zum Immunsystem. Wegen der starken genetischen Komponente empfiehlt es sich Prof. Philipsen zufolge generell, die Familienmitglieder von ADHS-Patientinnen und -Patienten ebenfalls zu screenen.
Bei erwachsenen Betroffenen kann man leitliniengerecht direkt mit der Psychopharmakotherapie beginnen. In Deutschland stehen dafür Methylphenidat, Lisdexamfetamin und Atomoxetin zur Verfügung. Laut einer Netzwerk-Metaanalyse schneiden Stimulanzien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Verträglichkeit besser ab als nicht-stimulierende Substanzen. Innerhalb dieser Gruppe wiederum zeigten Amphetamine tendenziell den größten Effekt. Atomoxetin ist ebenfalls wirksam, führt allerdings zu höheren Abbruchraten, eventuell wegen schlechterer Verträglichkeit.
Wichtig sei es, den individuell passenden Wirkstoff zu finden und diesen nicht zu niedrig zu dosieren, so Prof. Philipsen. Dabei müssen auch die Lebensumstände und die Tagesstruktur der Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden. Häufig sei ein spezielles Einnahmeschema sinnvoll, etwa zweimal täglich statt einmal. Hohe Off-Label-Dosierungen können zwar nötig sein, ziehen aber mitunter Regressforderungen nach sich. Mindestens einmal pro Jahr sollte ein Auslassversuch unternommen werden.
Verhaltenstherapie ist nur zweite Wahl
Verhaltenstherapeutische Interventionen sind nur die zweite Wahl und benötigen im Vergleich zur Pharmakotherapie vor allem mehr Zeit. Für viele Betroffene sei vermutlich eine Kombination aus Pharmako- und Psychotherapie optimal, so Prof. Philipsen. Diese sei derzeit aber nicht Standard in der Leitlinie.
Digitale Interventionen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Erste Studien belegen die Wirksamkeit von Therapie-Apps, die etwa als Überbrückung bis zum Beginn einer Psychotherapie oder ergänzend dazu genutzt werden können. Für zwei Anwendungen ist derzeit eine Zulassung als DiGA beantragt, eine weitere ist bereits kostenfrei verfügbar.
Quelle: Kongressbericht - 15. Psychiatrie-Update-Seminar
* Multimodal Treatment of ADHD
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).