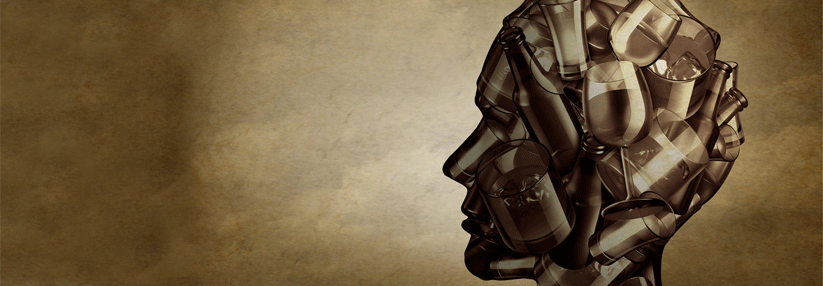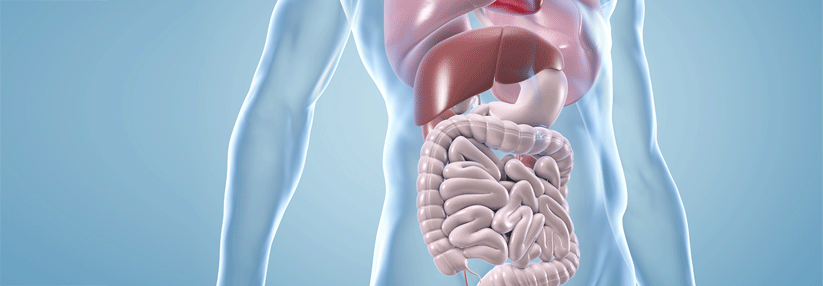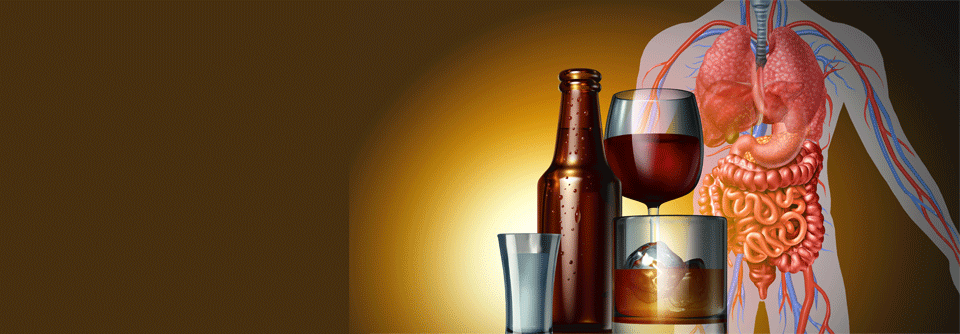Wie Medikamente bei Alkoholabhängigkeit helfen können
 Etwa die Hälfte der Alkoholkranken entwickelt körperliche und psychische Entzugszeichen, wenn das Trinken plötzlich gestoppt wird.
© encierro – stock.adobe.com
Etwa die Hälfte der Alkoholkranken entwickelt körperliche und psychische Entzugszeichen, wenn das Trinken plötzlich gestoppt wird.
© encierro – stock.adobe.com
Die Vorgaben, die bei der Therapie der Alkoholabhängigkeit gelten sollen, haben sich in den letzten Jahren geändert. Zwar bleibt die dauerhafte Abstinenz nach wie vor das ideale Ziel. Realistischer erscheint aber eine langfristige Reduzierung der Trinkmenge. Allerdings, das haben Studien gezeigt, lässt sich auf lange Sicht ein Komplettverzicht besser aufrechterhalten als ein verminderter Konsum, schreibt ein Autorenteam um den Berliner Neurologen und Psychiater Prof. Dr. Tilman Wetterling.
Zweierlei Wirkmechanismen dämpfen das Verlangen
In Deutschland sind bisher nur zwei Wirkstoffe zur Rückfallprophylaxe nach Alkoholentzug zugelassen: Acamprosat und Naltrexon. In der S3-Leitlinie zu Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen wird der Einsatz dieser Substanzen im Rahmen eines Gesamttherapieplans empfohlen. Zum Wirkmechanismus wird angenommen, dass Acamprosat das glutamaterge System im Gehirn moduliert und das Verlangen nach Alkohol verringert. Zu den häufigsten unerwünschten Nebeneffekten zählen Übelkeit und Meteorismus. Naltrexon ist ein Opioidantagonist, sein Metabolit 6-β-Naltrexol blockiert die µ-Opioidrezeptoren. Zudem besteht eine schwache antagonistische Wirkung an den d- und κ-Opioidrezeptoren. Eine Metaanalyse ergab, dass der Wirkstoff das Craving mindert, aber Müdigkeit und negative Affekte verstärkt.
Zur Reduktion der Trinkmenge bei Personen, die nicht in der Lage sind, Abstinenz zu erreichen, ist in Deutschland nur Nalmefen zugelassen. Es wirkt vor allem an den d- und µ-Opioidrezeptoren und beeinflusst das zerebrale Endorphinsystem. Nalmefen sollte nur verordnet werden, wenn die oder der Erkrankte fortgesetzt große Mengen Alkohol zu sich nimmt.
Entscheidend für die Prävention von Folgeschäden ist eine anhaltende, deutliche Verringerung der Trinkmenge. Die Studiendaten zur Trinkmengenreduzierung unter Acamprosat und Naltrexon sind widersprüchlich. So ergaben zwei Metaanalysen eine nicht ausreichende Wirkung, andere Arbeiten wiesen hingegen gute Effekte nach. Es gibt aber bislang nur wenig Daten zur Wirkung über einen Zeitraum von mehr als 24 Wochen.
Ein Langzeiterfolg ist keineswegs garantiert
Im Langzeitverlauf von 24 Wochen und länger erzielte Nalmefen gegenüber Placebo eine signifikante Reduktion sowohl von Gesamtalkoholmenge als auch der Tage mit starkem Konsum. Naltrexon und Acamprosat hingegen minderten weder die Zahl der Trinktage noch das Heavy Drinking. Für Topiramat ergaben Kurzzeitstudien (≤ 12 Wochen) einen Rückgang bei den schweren Konsumtagen und eine Zunahme der Tage mit Abstinenz.
Doch warum fällt der Therapieeffekt so gering aus? Wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, die vielschichtigen pharmakologischen Wirkungen des Alkohols durch ein einziges Medikament zu unterbinden, meint das Autorenteam. Zudem müssen bei vielen Betroffenen psychische Begleiterkrankungen wie eine Depression oder Angststörungen mitbehandelt werden. Aber adäquate arzneiliche Therapieoptionen für solche Doppeldiagnosen sind rar.
Zudem stufen 85 % der Alkoholkranken ihren Konsum nicht als problematisch ein. In einer Befragung zu den vorteilhaften Effekten des Trinkens nannten viele die beruhigende, angstmindernde und stimmungsaufhellende Wirkung des Alkohols. Dass diese Menschen ein Medikament einnehmen würden, um diese für sie positiven Effekte abzustellen, ist kaum zu erwarten. Und eine pharmakologische Substitutionstherapie ist, anders als bei Opiatabhängigkeit, nicht möglich.
Etwa die Hälfte der Alkoholkranken entwickelt körperliche und psychische Entzugszeichen, wenn das Trinken plötzlich gestoppt wird. Die Symptome beginnen meist innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem letzten Konsum. In einfach gelagerten Fällen kommt es zu vegetativer Überstimulation mit Herzrasen, Blutdruckanstieg, Übelkeit und psychischen Symptomen wie Unruhe, Ängstlichkeit und Schlafstörungen. Bei leichterer Ausprägung besteht keine Indikation zur medikamentösen Behandlung.
In schweren Fällen, insbesondere bei Komplikationen wie Delir oder Wernicke-Enzephalopathie, ist eine Pharmakotherapie angezeigt. Hierzu steht eine ganze Reihe an Wirkstoffen zur Verfügung, aber kaum kontrollierte Vergleichsstudien. In der Leitlinie wird zu Benzodiazepinen, Clomethiazol und Antikonvulsiva geraten. Krampfanfälle im Entzug lassen sich laut den Ergebnissen einer Metaanalyse ebenfalls mit Clomethiazol mindern, auch Diazepam, Lorazepam und Valproinsäure haben sich als wirksam erwiesen. Delirien kann demnach mit Diazepam begegnet werden.
Quelle: Wetterling T et al. Psychopharmakotherapie 2025; 32: 50-55
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).