
Wie sich die Refluxkrankheit effektiv behandeln lässt
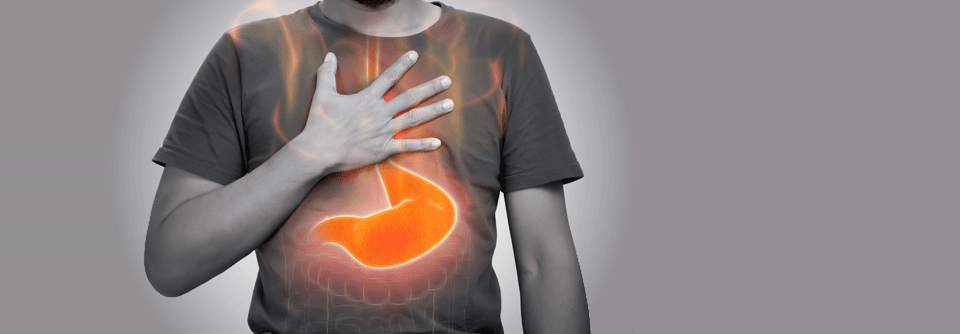 Bei Menschen mit gastroösophagealer Refluxkrankheit ist eine dauerhafte Änderung des Lebensstils oberstes Gebot.
© eddows - stock.adobe.com
Bei Menschen mit gastroösophagealer Refluxkrankheit ist eine dauerhafte Änderung des Lebensstils oberstes Gebot.
© eddows - stock.adobe.com
Zu den typischen Beschwerden bei der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD) gehören Sodbrennen und saure Regurgitation, zu den untypischen Heiserkeit, Globusgefühl, chronischer Husten und Brustschmerz. Bei klassischen Symptomen kann die Diagnose bereits klinisch gestellt werden, sofern keine Alarmzeichen vorliegen, wie Dysphagie, Anämie, gastrointestinale Blutungen und Gewichtsverlust. Empfohlen wird eine achtwöchige empirische Therapie mit einem Protonenpumpenhemmer (PPI). Allerdings hat das Ansprechen auf PPI nur eine Sensitivität von 71 % und eine Spezifität von 44 %.
Als erste apparative Diagnostik wird meist eine Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) durchgeführt. Für eine optimale Aussagekraft sollte diese idealerweise zwei bis vier Wochen nach dem Absetzen einer etwaigen PPI-Therapie erfolgen. Außerdem ist zu beachten, dass bis zu 70 % der Erkrankten eine gesunde Mukosa aufweisen, so das Autorenteam um Dr. Hannah Philips von der Mayo Clinic in Rochester.
Der nächste Schritt bei negativer ÖGD ist die ambulante pH-Metrie. PPI sollten mindestens eine Woche zuvor abgesetzt werden, H2-Rezeptorantagonisten mindestens drei Tage. Als Schwellenwert für einen pathologischen Reflux gilt ein pH-Wert ≤ 4. Die Säureexpositionszeit ist der beste Parameter für ein Ansprechen auf PPI bzw. Operation.
Schlafen mit erhöhtem Kopf und leerem Magen
Mit allen Betroffenen sollte man über Lebensstilveränderungen sprechen. Dazu gehören das Schlafen mit erhöhtem Kopfende (15–20 cm) und ein Abstand von drei bis vier Stunden zwischen letzter Mahlzeit und Zubettgehen. Auslöser wie Kaffee, Kohlensäure, Tomaten etc. gilt es zu meiden, die Gewichtsabnahme ist vor allem bei Adipositas dringlich.
Von Antazida profitieren v. a. Erkrankte ohne erosive Ösophagitis, die seltener als zweimal wöchentlich Symptome haben. Sie eignen sich ebenso wie Antihistaminika zur Bedarfstherapie. Schon nach 14 Tagen Dauereinsatz kann eine Tachyphylaxie auftreten. Bei ausgeprägten GERD-Beschwerden oder erosivem Befall sind PPI Mittel der ersten Wahl. Sie erreichen eine stärkere Säureinhibition als H2-Rezeptorantagonisten. Voraussetzung für den Einsatz ist eine gesicherte GERD-Diagnose. Zudem sollten die PPI mindestens 30 bis 60 Minuten vor einer Mahlzeit eingenommen werden.
In schweren Fällen erfolgt die Therapie lebenslang
Für Erkrankte mit einer Ösophagitis Grad C und D nach der Los-Angeles-Klassifikation wird eine zweimal tägliche PPI-Einnahme über mindestens sechs bis acht Wochen empfohlen, gefolgt von einer ÖGD-Kontrolle (Abheilung, Barrett-Ausschluss). Personen mit Grad C und D, peptischer Striktur oder Barrett-Ösophagus sollten zeitlebens mindestens einmal täglich einen PPI einnehmen, unabhängig von den Beschwerden. Im Fall einer nicht-erosiven GERD erfolgt zunächst eine achtwöchige Therapie. Sie kann beendet werden, wenn die Lebensstilinterventionen greifen. Personen mit nachgewiesener Refluxkrankheit, die wegen persistierender Symptome nicht auf PPI verzichten können, sollten diese in möglichst niedriger Dosis einnehmen.
Bei Beschwerden trotz einmal täglicher Medikation über zwei bis zwölf Wochen kann eine zweimal tägliche Gabe versucht werden. Falls das nicht genügt, sollte mittels Ösophagusimpedanzmessung ein refraktärer Reflux ausgeschlossen werden. Liegt dieser vor, profitieren Patientinnen und Patienten eventuell von der zusätzlichen Einnahme eines Antihistaminikums zur Nacht.
PPI gelten im Allgemeinen als sicher. Etwaige Nebenwirkungen wurden überwiegend aus Studien von geringer Qualität berichtet. Zahlreiche andere Arbeiten fanden solche Assoziationen nicht. Dennoch sollte man diese Wirkstoffe nicht ohne klare Indikation dauerhaft verschreiben.
Operation ist keine Garantie für Medikamentenfreiheit
Für eine Operation können Erkrankte mit gesicherter GERD und persistierenden Refluxsymptomen trotz angepasstem Lebensstil und optimaler Medikation in Betracht gezogen werden. Auch bei anatomischen Veränderungen (z. B. große Hiatushernie) sollte die chirurgische Lösung erwogen werden. Ausgewählten Patientinnen und Patienten kann man die transorale inzisionslose Fundoplicatio als weniger invasive Option empfehlen, sie lässt sich mit einer Hernienkorrektur kombinieren. Die genannten Eingriffe sind zwar sehr effektiv, sie garantieren aber nicht, dass die Betroffenen in Zukunft keine Säurehemmer mehr benötigen.
Quelle: Philips HR et al. Mayo Clin Proc 2025; 100: 882-889; doi: 10.1016/j.mayocp.2025.01.022
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).


