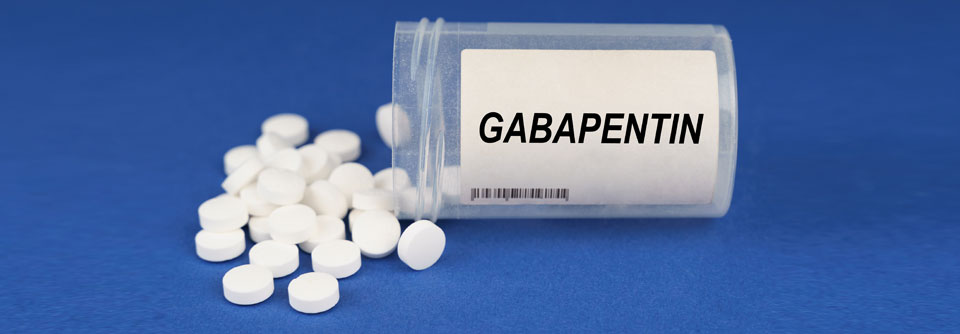
Wie sich Gabapentinoide auf selbstverletzendes Verhalten auswirken
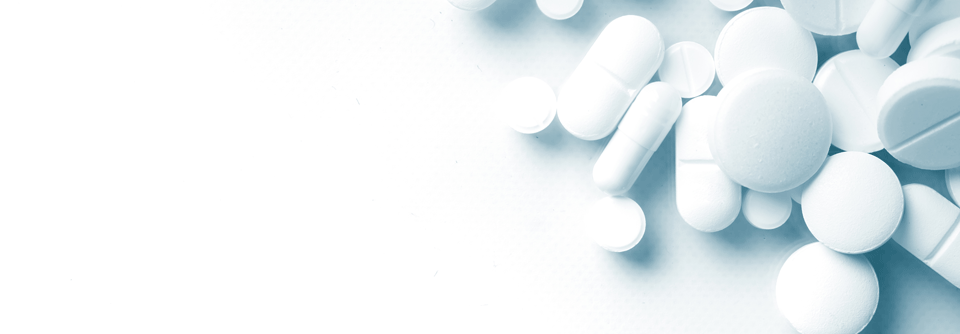 Ein direkter Einfluss der Substanzen auf Selbstverletzungen sei unwahrscheinlich, schreibt die Autorengruppe.
© zadorozhna - stock.adobe.com
Ein direkter Einfluss der Substanzen auf Selbstverletzungen sei unwahrscheinlich, schreibt die Autorengruppe.
© zadorozhna - stock.adobe.com
Beide Substanzen kommen zudem bei weiteren Indikationen zum Einsatz, etwa in der Hälfte der Fälle geschieht dies off label. Die in früheren Studien teils widersprüchlich aufgezeigten Risiken für selbstverletzendes Verhalten nach Einnahme der Gabapentinoide nahm eine Forschergruppe zum Anlass für eine Bewertung.
Im Rahmen der bevölkerungsbasierten, selbstkontrollierten Fallserienstudie hatte das Team um Andrew Yuen vom University College London die Daten von 10.002 Erwachsenen ab 18 Jahren analysiert. Die Teilnehmenden hatten mindestens eine Verschreibung für Gabapentinoide erhalten und waren zwischen dem 1. Januar 2000 und 31. Dezember 2020 wegen des selbstverletzenden Verhaltens in der Krankenhausstatistik aufgetaucht.
Inzidenzraten vor Therapie höher als währenddessen
Um das Risiko von Selbstverletzungen in verschiedenen Risikoperioden im Vergleich zum Referenzzeitraum für jede Person bewerten zu können, wurden die Inzidenzraten für entsprechende Ereignisse 90 Tage vor Beginn der Gabapentinoid-Medikation, während der Behandlungsphase und 14 Tage nach Beendigung der Therapie ermittelt, erläutert die Expertengruppe.
Die Inzidenzrate von Selbstverletzungen pro 100 Personenjahre betrug 16,79 in den 90 Tagen vor Behandlungsbeginn, 9,66 während der Behandlungsperiode und 29,60 zwei Wochen nach Therapieende. In der Referenzphase – dem Zeitraum außerhalb der drei anderen Kategorien – lag die Inzidenzrate bei 6,75.
Die Ergebnisse zeigten ein erhöhtes Risiko für Selbstverletzungen bereits in den 90 Tagen vor Behandlungsbeginn mit einem adjustierten Inzidenzratenverhältnis, aIRR, von 1,69, schreiben die Kolleginnen und Kollegen. Zu Therapiebeginn war das Selbstverletzungsrisiko allmählich rückläufig und kehrte während der Behandlungsphase auf Referenzniveau zurück (aIRR 1,06). Nach Behandlungsende stieg es dann innerhalb von 14 Tagen wieder an (aIRR 3,02).
Ein direkter Einfluss der Substanzen auf Selbstverletzungen sei unwahrscheinlich, schreibt die Autorengruppe. Sie betont aber die Notwendigkeit einer engmaschigen Überwachung während der gesamten Behandlungszeit.
Die Kommentatoren Dr. Amir Sariaslan und Prof. Dr. Seena Fazel von der University of Oxford beanstanden die Interpretation der Ergebnisse. Sie verweisen auf eine Datenbankanalyse aus Schweden, in der über ein durchgängig hohes Risiko für suizidales Verhalten während der Behandlungszeiträume in allen Altersgruppen berichtet wurde. Für die Zukunft wünschen sie sich die Zusammenführung von Analysen mehrerer großer Datenbanken, um methodisch bedingte Ergebnisse von tatsächlichen Auswirkungen trennen zu können.
Quelle: 1.Yuen ASC et al. BMJ 2025; 389: e081627; doi: 10.1136/bmj-2024-081627
2.Sariaslan A, Fazel S. BMJ 2025; 389: r634; doi: 10.1136/bmj.r634
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).



