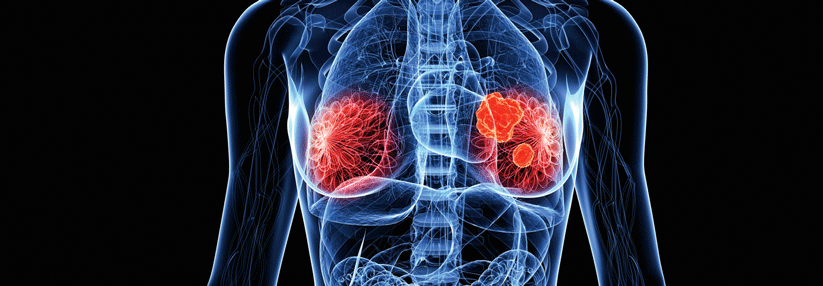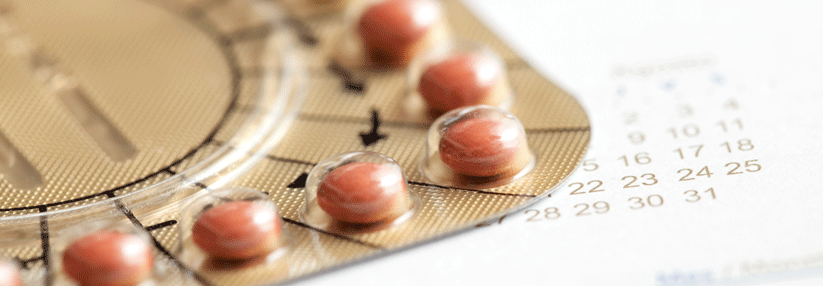Wie sollten Betroffene vor und nach der Therapie beraten werden?
 Schwangerschaft und Kinderwunsch erfordern bei jungen Brustkrebspatient:innen vor und nach Therapie besondere Beachtung.
© nataliaderiabina – stock.adobe.com
Schwangerschaft und Kinderwunsch erfordern bei jungen Brustkrebspatient:innen vor und nach Therapie besondere Beachtung.
© nataliaderiabina – stock.adobe.com
Junge Brustkrebserkrankte entwickeln häufig aggressivere Mammakarzinomsubtypen, die eine (neo-)adjuvante Chemotherapie nötig machen. Diese schränkt die Fertilität stark ein. Auch Erhaltungsstrategien – endokrine Therapie (ET), CDK4/6-Inhibitoren oder Olaparib – können ein Problem darstellen.
Fertilitätserhalt vor Therapie ansprechen
„Man weiß aus Studien, dass 64 % aller Frauen unter 40 mit der Diagnose Mammakarzinom einen latenten Kinderwunsch haben, den sie aber häufig ihren Therapierenden gegenüber gar nicht explizit äußern“, erklärte Prof. Dr. Tanja Fehm, Universitätsklinikum Düsseldorf, und appellierte: „Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie den Fertilitätserhalt und die Möglichkeiten einer Schwangerschaft nach der Therapie thematisieren. Denn die Frauen befinden sich ja in einem Ausnahmezustand, in dem das Thema Kind momentan in den Hintergrund gerückt ist.“
Bis zu einem Alter von 40 Jahren übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen den Fertilitätserhalt. Jede Patientin im fertilen Alter müsse über die Möglichkeiten aufgeklärt werden, betonte Prof. Fehm. Folgende Fragen sollte man zur Risikoabschätzung abklären:
- Ist der Therapieansatz kurativ?
- Ist eine spätere Schwangerschaft mit der Grunderkrankung und der Behandlung vereinbar?
- Besteht ein moderates bis hohes Risiko einer therapieinduzierten Sterilität?
- Ist eine fertilitätsprotektive Behandlung ohne relevantes Risiko für die betroffene Person durchführbar?
Drei mögliche Verfahren stehen zur Auswahl
Bei Interesse an fertilitätserhaltenden Maßnahmen sollte die Patientin an einen Spezialisten oder eine Spezialistin mit Expertise auf dem Gebiet der Gonadenprotektion überwiesen werden. Derzeit gibt es für Betroffene drei Methoden:
- Die Kryokonservierung (un-)fertilisierter Oozyten,
- die Krykonservierung von Ovarialgewebe und
- die Gabe von GnRH-Agonisten zur Ovarsuppression, was in der Regel nicht über das reproduktionsmedizinische Zentrum, sondern im Rahmen der onkologischen Therapie erfolgt.
Heute werden meist unbefruchtete Eizellen kryokonserviert, da dies auch einen Eizelltransfer bei Partner:innenwechsel ermöglicht. Mittlerweile gebe es gute Protokolle für die hierfür notwendige hormonelle Stimulation, die für Mammakarzinomerkrankte sowohl vor dem Therapiestart als auch nach der Behandlung onkologisch sicher sind, betonte Prof. Fehm. Dies sei auch in großen Metaanalysen gezeigt worden. Die Baby-Take-Home-Rate beträgt bei dieser Methode zwischen 20 % und 35 %.
Der Vorteil der Kryokonservierung von Ovargewebe: Sie erfordert keine ovarielle Stimulation und das Verfahren ist innerhalb weniger Tage umsetzbar, wobei der operative Eingriff natürlich eine gewisse Infrastruktur notwendig macht. Liegen BRCA1/2-Mutationen vor, besteht allerdings die Gefahr einer Tumorzellverschleppung. Bei diesen Erkrankten müsse daher nach Abschluss des Verfahrens das transplantierte Ovargewebe wieder explantiert werden, so Prof. Fehm. Die Lebendgeburtrate betrage hier um die 20 %.
Am unkompliziertesten ist die Ovarsuppression mittels GnRH-Analoga, die idealerweise zwei Wochen vor der Chemotherapie begonnen werden sollte. „Allerdings ist das nicht die zuverlässigste Methode für den Fertilitätserhalt“, kommentierte die Referentin. Gemäß den aktuellen Leitlinien sollen GnRH-Agonisten nicht als zuverlässige Maßnahme angeboten werden, da sie als alleinige Option nicht ausreichend sind. Prof. Fehm: „Es verkürzt die Amenorrhoedauer, aber wir haben keinen Beweis dafür, dass sich hierdurch die Schwangerschaftsrate erhöht.“
Aufklärung dokumentieren
Das Gespräch über den Fertilitätserhalt sollte unbedingt adäquat dokumentiert werden. Entsprechende Vorlagen zur Dokumentation finden sich unter www.krebsgesellschaft.de/zertdokumente.html. „Diese Dokumente erweisen sich im klinischen Alltag als sehr hilfreich“, so Prof. Fehm.
Wann können Betroffene eine Schwangerschaft anstreben?
Grundsätzlich sollte den Erkrankten – eine kurative Situation vorausgesetzt – unabhängig vom Hormonrezeptorstatus des Tumors nicht von einer Schwangerschaft abgeraten werden. „Wir wissen, dass sich durch eine Schwangerschaft die Prognose nicht verschlechtert“, betonte Prof. Fehm. Trotzdem sollte bei der Beratung das individuelle Rezidivrisiko thematisiert werden.
Bei HR- Personen, die in der Regel eine Chemotherapie erhalten haben, sollte man wegen der Wash-out-Phase mindestens sechs Monate nach Ende der Chemo abwarten. Allerdings laute die allgemeine Leitlinienempfehlung für Betroffene mit HR- Karzinomen, sich mindestens zwei Jahre nach Therapieende – und damit für die Phase des höchsten Rezidivrisikos – zu gedulden. Im Falle eines Lymphknotenbefalls sind es sogar fünf Jahre.
Auch Bisphosphonate müssten bei einem Kinderwunsch aufgrund der Gefahr von Knochenfehlbildungen abgesetzt werden, so Prof. Fehm. Die Wash-out-Phase beträgt auch hier sechs Monate.
Unterbrechung der ET für maximal zwei Jahre sicher
Personen mit HR+ Tumoren erhalten eine ET in der Regel über fünf Jahre. Diese sollte frühestens nach 18 Monaten unterbrochen werden, um eine Schwangerschaft anzustreben. Nach der Schwangerschaft sollte sie bis zur Komplettierung der fünf oder sogar zehn Jahre fortgeführt werden. „Aber auch bei der ET ist eine Wash-out-Phase notwendig, die mindestens sechs Monate dauern sollte“, erklärte Prof. Fehm.
Dass diese Unterbrechung der ET für eine Schwangerschaft für bis zu zwei Jahre sicher ist, hatten Forschende in der POSITIVE-Studie zumindest im Kurzzeit Follow-up demonstriert. Eine längere Nachbeobachtungszeit wäre natürlich vor allem beim HR+ Mammakarzinom wünschenswert, so Prof. Fehm. Aus ihrer Sicht könne man dieses Konzept allerdings nicht allen Erkrankten mit HR+ Tumoren anbieten. Deutlich erhöhte Rezidivraten ergaben sich nämlich in POSITIVE für diejenigen mit 4–9 befallenen Lymphknoten sowie mit Tumoren über 5 cm. „Das müssen Sie mit Ihren Patientinnen also reflektieren“, so die Referentin.
Im Rahmen der Studie evaluierten die Verantwortlichen zudem das Stillen. Auch hierfür wurde kein nachteiliger Effekt beobachtet. Prof. Fehms Fazit: „Man kann also den Patientinnen wirklich Mut machen: Sowohl die Schwangerschaft nach Mammakarzinom als auch das Stillen verschlechtern die Prognose nicht.“
Quelle:
Fehm T et al. 44. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Senologie; Vortrag „Kinderwunsch und Schwangerschaft – wie beraten?“
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).