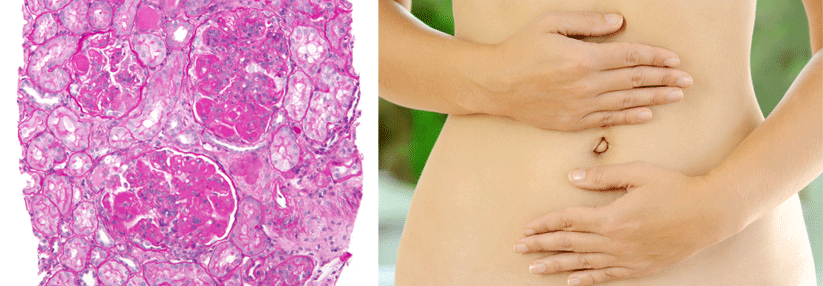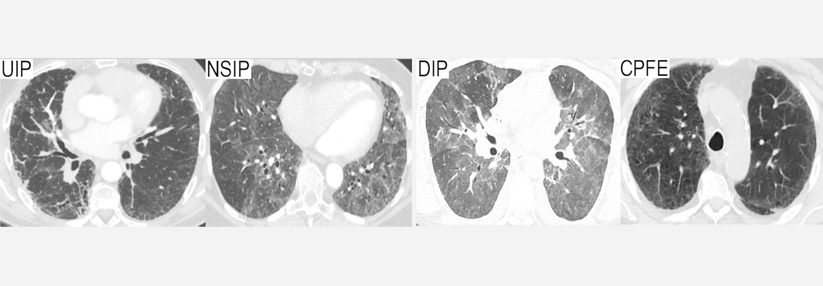Worauf es bei der Therapie ankommt
 Die Therapie mit Hydroxychloroquin kann während der Gravidität fortgesetzt oder vor der Konzeption begonnen werden.
© Alessandro Grandini – stock.adobe.com
Die Therapie mit Hydroxychloroquin kann während der Gravidität fortgesetzt oder vor der Konzeption begonnen werden.
© Alessandro Grandini – stock.adobe.com
Generell gilt, dass alle Patientinnen und Patienten mit begründetem Verdacht auf Lupus erythematodes (SLE) zur Verifizierung einem Spezialisten vorgestellt werden sollen. Außerdem wird empfohlen, bei jedem Kontakt den klinischen Status und die Krankheitsaktivität zu erfassen. Wichtig ist auch die einmal jährliche Dokumentation bereits eingetretener Schäden.
Die Behandlung erfolgt nach dem Prinzip Treat-to-Target. Hydroxychloroquin (HCQ) wird für alle Patientinnen und Patienten mit SLE ab dem Zeitpunkt der Diagnose empfohlen, die Zieldosis liegt bei 5 mg/kg. Einen hohen Stellenwert besitzen zudem die Glukokortikoide. Die Menge richtet sich nach Art und Schwere der Organmanifestationen. Mittelschwer bis schwer Erkrankte profitieren eventuell von einer intravenösen Stoßtherapie mit (Methyl-)Prednisolon (125–1.000 mg) über ein bis drei Tage. Angestrebt wird eine Erhaltungsdosis von ≤ 5 mg/d Prednisolonäquivalent, wenn möglich sogar ein vollständiges Absetzen.
Bei unzureichender Kontrolle Immunsuppressiva erwägen
Wenn sich die klinischen Manifestationen mit HCQ und maximal 5 mg/d Prednisolonäquivalent nur unzureichend kontrollieren lassen, sollte eine immunsuppressive bzw. -modulierende Therapie erfolgen. Geeignet sind Azathioprin, Methotrexat, Mycophenolat (bzw. Mycophenolsäure) und Biologika (Anifrolumab, Belimumab).
Bei organ- oder vitalbedrohlichen extrarenalen Manifestationen ist eine i. v. Behandlung mit Cyclophosphamid angeraten, in refraktären Fällen eine B-Zell depletierende Therapie. Sobald eine anhaltende Remission erreicht ist, sollte die Medikation schrittweise ausgeschlichen werden, beginnend mit dem Steroid, heißt es in der Leitlinie der DGRh* und weiterer Fachgesellschaften.
Beim erstmaligen Auftreten einer Lupusnephritis heißt das Ziel komplettes renales Ansprechen. Definiert wird dieses durch eine Proteinurie < 0,5–0,7 g/d bzw. eine Urin-Protein-Kreatinin-Ratio (UPCR) < 0,5–0,7 mg/g. Hydroxychloroquin sollen alle Personen mit Lupusnephritis erhalten (Ziel 5 mg/kg), bei einer GFR unter 30 ml/min mit halber Dosis.
Erkrankte mit aktiver proliferativer Nierenentzündung werden initial am besten mit Cyclophosphamid i. v. oder Mycophenolat (bzw. Mycophenolsäure) behandelt, jeweils in Kombination mit einem Glukokortikoid. Zur Reduktion der kumulativen Dosis wird Letzteres am besten als Pulstherapie verabreicht, gefolgt von einer oralen Behandlung (0,3–0,5 mg/kg/d). Nach einem Vierteljahr sollte der Erkrankte weniger als 10 mg/d einnehmen, nach sechs Monaten maximal 5 mg täglich. Wenn ein renales Ansprechen erreicht ist, rät die Leitlinie, die Therapie noch mindestens drei Jahre fortzuführen. Dazu eignen sich Mycophenolat (bzw. Mycophenolsäure) allein oder zusammen mit Belimumab bzw. Calcineurin-Inhibitoren.
Das Antiphospholipidsyndrom (APS) erfordert ein besonderes Augenmerk auf die Gerinnung. Bei SLE-Betroffenen ohne stattgehabte Thrombose oder antiphospholipidantikörper(APL)-assoziierte Schwangerschaftskomplikationen richtet sich das Vorgehen nach der Gefährdung: Liegt ein Hochrisikoprofil vor (gleichzeitige Präsenz aller drei Antikörper, hohe Antikörpertiter und/oder Nachweis von Lupus-Antikoagulans), wird eine niedrig dosierte ASS-Prophylaxe empfohlen. Erkrankte mit APS und erster Venenthrombose sollen einen Vitamin-K-Antagonisten einnehmen (INR 2–3). Von NOAK rät die Leitlinie beim thromboembolischen APS wegen der höheren Gefahr für arterielle Gefäßereignisse und Blutungen ab.
Vitamin-K-Antagonisten und ASS eventuell kombinieren
Bei einem SLE mit erstmaliger APL-assoziierter arterieller Komplikation sollten Vitamin-K-Antagonisten gegenüber der alleinigen ASS-Gabe präferiert werden. In Abhängigkeit vom Hämorrhagie- und Thromboserisiko wird eine INR von 2–3 oder 3–4 angestrebt. Auch die Kombination von Vitamin-K-Antagonisten mit INR 2–3 und niedrig dosierter ASS kommt in Betracht.
Die Therapie mit Hydroxychloroquin kann während der Gravidität fortgesetzt oder vor der Konzeption begonnen werden. Zur Prophylaxe und Behandlung von Schüben eignen sich Glukokortikoide (oral und i. v.), Azathioprin, Ciclosporin und Tacrolimus. Nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung ist die Gabe von Belimumab und Rituximab vor der geplanten Konzeption möglich. Gegen mittelschwere und schwere Exazerbationen während der Schwangerschaft sind Steroide (Bolustherapie), i. v. Immunglobuline oder Plasmapherese eine Option. Teratogene Substanzen wie Mycophenolat, Cyclophosphamid und Methotrexat gelten als tabu. Alle Patientinnen mit SLE sollen während der Gravidität niedrig dosiertes ASS einnehmen.
* Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie
Quelle: S3-Leitlinie „Management des systemischen Lupus erythematodes“; AWMF-Register-Nr. 060/008; www.awmf.org
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).