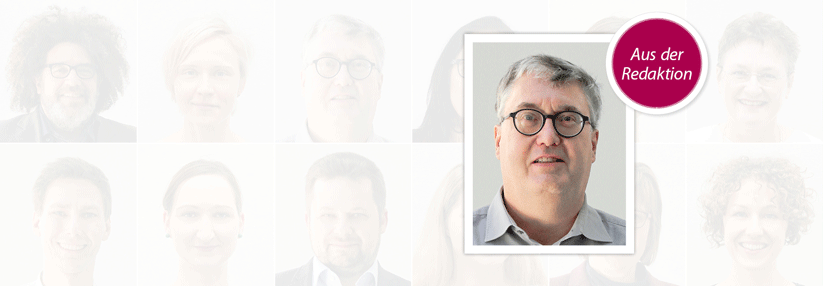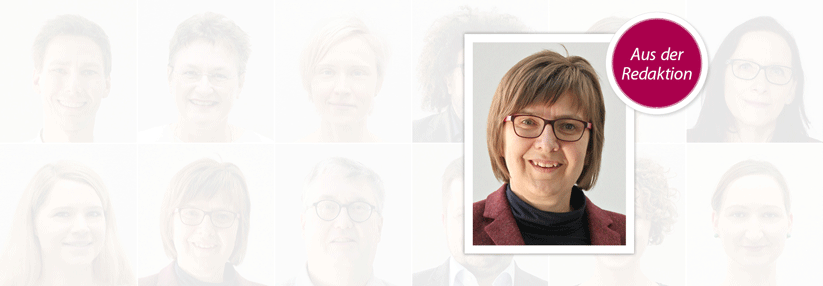Rasse statt Klasse
 © MT
© MT
Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, den Begriff „Rasse“ in heutigen Zeiten noch zu verwenden – so lautet das Fazit einer UNESCO-Stellungnahme aus dem Jahr 1995. Und doch höre ich das leidige Wort auf jedem medizinischen Kongress, den ich besuche, mehrfach. Jedes Mal zucke ich zusammen, jedes Mal schaue ich mich danach im Plenum um, ob es außer mir noch jemandem so geht. Und jedes Mal bin ich überrascht, dass sich anscheinend sonst niemand daran stört. Wie kann das sein?
Wer in den Vereinigten Staaten an einer klinischen Studie teilnehmen möchte, muss neben Angaben zu Größe, Gewicht und Alter auch welche zu seiner „race“ machen. Mithilfe der so gewonnenen Daten sollen laut FDA beispielsweise epidemiologische Unterschiede identifiziert und analysiert werden. Zwar basiert das gesetzte Kreuzchen auf der reinen Selbsteinschätzung der Teilnehmer innerhalb eines fragwürdigen, weil vollkommen willkürlichen, Katalogs an Auswahlmöglichkeiten. Behandelt wird der Parameter aber als wäre er ein Hard Fact.
Die resultierenden Publikationen landen letztlich zu Hunderten und Tausenden auf den Schreibtischen. Eingehüllt in ihr Tarnkleid aus 95%-Konfidenzintervallen, Hazard Ratios und p-Werten kommen „Black“ und „White“ plötzlich hochwissenschaftlich daher. Welche noch so unterschiedlichen Individuen und Subgruppen unter den Begriffen zusammengefasst werden, spielt für Leser und Forscher dann keine Rolle mehr.
Dabei ist längt erwiesen, dass die Unterschiede innerhalb der einzelnen Gruppen in aller Regel größer sind als dazwischen. Auch was die einzelnen Studienteilnehmer dazu verleitet hat, ihr Kreuzchen bei der einen und nicht einer anderen Gruppe zu setzen, interessiert nicht.
Und nach hundertfachem Lesen runzelt kaum mehr jemand die Stirn, wenn ein längst obsoletes Konzept immer noch in aller Munde ist. Schließlich steht doch ein p-Wert dahinter! Da kann es doch nicht verwerflich sein!
Für den Praxisalltag ist eine solche Klassifikation ohnehin nicht von Relevanz. Fragen Sie Ihren Patienten im Rahmen der Anamnese etwa, welcher Gruppe er sich zugehörig fühlt? Oder übernehmen Sie die Kategorisierung gar selbst, nach Augenmaß? Wohl kaum. Vielmehr werden Sie sich erkundigen, wo es denn bei ihm hakt, ob Vorerkrankungen bestehen, wie es mit der Einnahme von Medikamenten und mit der Familienanamnese aussieht. Die wichtigen Fragen eben, die für Diagnostik und Therapie tatsächlich eine Rolle spielen.
Kathrin Strobel
Redakteurin Medizin