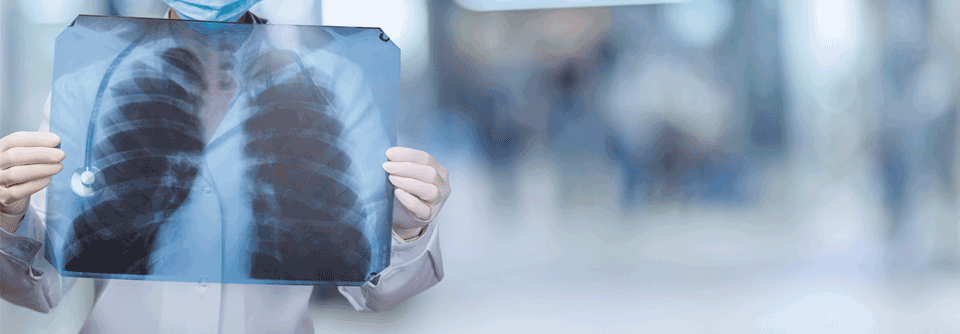Amoxicillin erhält Vorfahrt bei HNO-Infektionen
 Neu ist die Leitlinienempfehlung, in fast allen diesen Fällen primär Amoxicillin zu geben.
© Nadzeya - stock.adobe.com
Neu ist die Leitlinienempfehlung, in fast allen diesen Fällen primär Amoxicillin zu geben.
© Nadzeya - stock.adobe.com
Liegt nur eine leichte akute bakterielle HNO-Infektion vor, benötigen Immunkompetente in der Regel kein Antibiotikum – an dieser Einschätzung hat sich in der S2k-Leitlinie, die von der HNO-ärztlichen und weiteren deutschen Fachgesellschaften überarbeitet wurde, nichts geändert. Zum einen kann die Krankheitsdauer durch den Einsatz dieser Medikamente nur minimal verkürzt werden, zum anderen lassen sich Symptome mit anderen Maßnahmen (z. B. Gabe lokaler und/oder systemischer Antiphlogistika) oft genauso gut lindern, lautet die Argumentation. „In vielen Fällen dient eine Antibiotikaverordnung überwiegend der Beruhigung von Arzt und Patient“, heißt es.
Ist die Indikation für eine antibakterielle Therapie aufgrund der Schwere der Infektion oder dem individuellen Risiko des/der Erkrankten gegeben, sollte man sich für das Antibiotikum mit dem schmalstmöglichen Wirkspektrum entscheiden und die empfohlene Behandlungsdauer beachten. Dies reduziert die unerwünschten Effekte und den bakteriellen Selektionsdruck, schreiben die Leitlinienexpertinnen und -experten. Breitspektrumantibiotika erhöhen dagegen das Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen und offenbar die Sepsisgefahr in den Folgemonaten. Auch scheinen breit wirksame Substanzen in der Primärtherapie von leichten und mittelschweren Infektionen keinen besseren Effekt zu haben als solche, die nur auf wenige Erreger zielen.
Eine bakteriell bedingte Tonsillopharyngitis verläuft in der Regel selbstlimitierend. Nur wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion mit A-Streptokokken hoch ist (Centor- oder McIsaac-Score ≥ 3 Punkte) und ein schweres Krankheitsbild vorliegt, wird antibiotisch behandelt. Dabei gilt nach wie vor Penicillin V als Mittel der Wahl. Alternativ kommen die beiden Oralcephalosporine der Gruppe 1, Cefalexin und Cefadroxil, sowie Clarithromycin und Clindamycin in Betracht.
Eine akute Otitis media geht ebenfalls meist von allein zurück. Indiziert ist die Antibiotikagabe nur, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien vorliegt:
- schwere Mittelohrentzündung
- Manifestation in den ersten sechs Lebensmonaten
- beidseitige Erkrankung in den ersten zwei Lebensjahren
- Otorrhö mit persistierenden Schmerzen und/oder Fieber
- Risikopatient (durch z. B. Immundefizit, schwere Grunderkrankung, Paukenröhrchen, Influenza)
Neu ist die Leitlinienempfehlung, in fast allen diesen Fällen primär Amoxicillin zu geben. Denn wie für Kinder gezeigt wurde, kommt es unter der Substanz seltener zu Therapieversagen bzw. Rezidiven als unter Amoxicillin-Clavulansäure, Azithromycin oder einem Cephalosporin. Nur in Risikogruppen und bei wiederholten Rezidiven kommt bereits initial die Kombination aus einem Aminopenicillin und einem Betalaktamantibiotikum zum Einsatz.
Haben sich die Otitissymptome nach zwei Tagen Amoxicillin nicht gebessert, kann man ab Tag 3 auf Amoxicillin-Clavulansäure oder Sultamicillin umstellen. Bei einem perforierten Trommelfell und eitriger Otorrhö wird man allerdings – geringe Beschwerden vorausgesetzt – das Abstrichergebnis abwarten, um dann gezielt und möglichst schmalspurig zu behandeln.
Auch bei der akuten unkomplizierten Rhinosinusitis hat die Monotherapie mit Amoxicillin jetzt Vorfahrt, sofern man die Infektion überhaupt antibiotisch angehen möchte. Um die fakultative Indikation zu rechtfertigen, sollten mindestens drei der folgenden Punkte erfüllt sein:
- Fieber > 38 °C
- biphasischer Verlauf
- einseitige Beschwerden, starke Schmerzen
- erhöhtes CRP
Im Fall einer drohenden Komplikation verordnet man die Kombination aus einem Aminopenicillin und Betalaktamaseinhibitor.
Erkrankungen, die primär durch Staph. aureus und ggf. alternativ durch Streptokokken verursacht sind, sollen gemäß der Leitlinie mit Cephalosporinen der Gruppe 1 (Cefalexin oder Cefadroxil oral, Cefazolin parenteral) therapiert werden. Dies gilt u. a. für Furunkel, regionäre Lymphadenitis colli, umschriebene tiefe Weichgewebsinfektionen, (postoperative) Wundinfektionen, Sialadenitis von Immunkompetenten und Tonsillitisrezidive nach Penicillintherapie.
Oralcephalosporine der Gruppe 2 (Cefuroximaxetil) und 3 (Cefpodoximproxetil) sind bei akuter bakterieller Rhinosinusitis und Otitis media nur noch dann indiziert, wenn Amoxicillin nicht gegeben werden kann.
Aufgrund zunehmender Resistenzraten hat Clindamycin ausschließlich bei leichten bis mittelschweren Mischinfektionen und anamnestischer Typ-1-Allergie gegen Penicillin einen Platz. Stark eingeschränkt ist auch das Anwendungsspektrum der Fluorchinolone. Bei leichten, selbstlimitierenden Infektionen darf man sie gar nicht mehr, bei mittelschweren nur bei fehlenden Therapiealternativen verordnen.
QUelle: S2k-Leitlinie „Antibiotikatherapie von HNO-Infektionen“; AWMF-Register-Nr. 017/066; www.awmf.org
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).