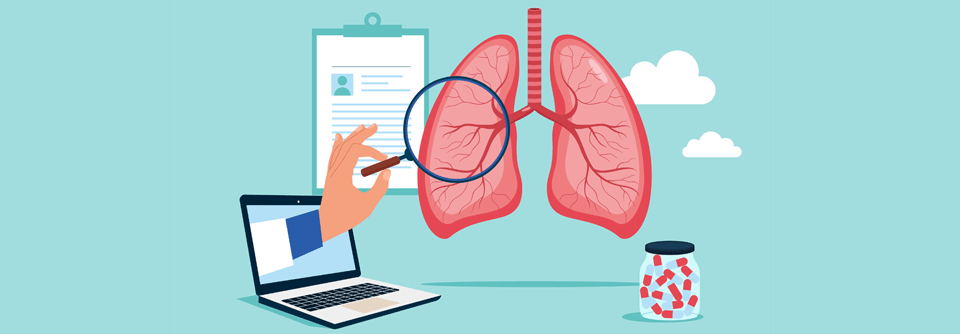Behandlungsspektrum beim NSCLC erweitert
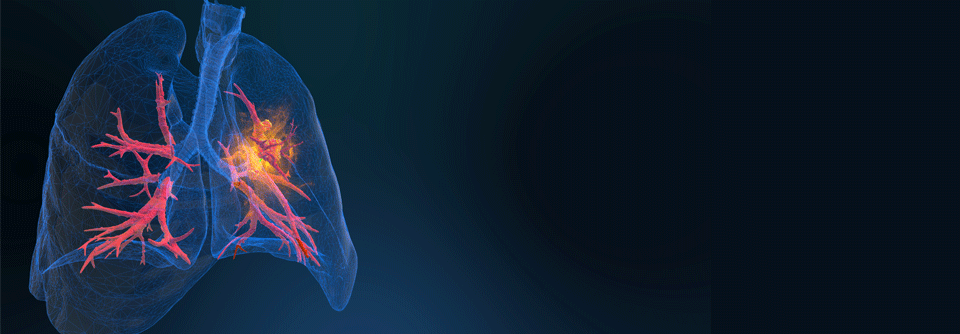 In der Krebstherapie gewinnen immunologische Ansätze zunehmend an Bedeutung, so auch beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom.
© appledesign - stock.adobe.com
In der Krebstherapie gewinnen immunologische Ansätze zunehmend an Bedeutung, so auch beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom.
© appledesign - stock.adobe.com
Um zu klären, inwieweit eine Patientin oder ein Patient mit NSCLC von einer der neuen zielgerichteten Substanzen profitieren könnte, muss zunächst in dem entnommenen Tumorgewebe nach den passenden Zielstrukturen gesucht werden. Molekularpathologisch geht es dabei z. B. um EGFR- und ALK-Alterationen. Bei der immunhistochemischen Untersuchung dreht es sich in den meisten Fällen um die PD-L1*-Expression. Je nach Analyseergebnis, Stadium und Resektabilität des Tumors rät das Autorenteam einer gemeinsamen S3-Leitlinie von DGP und DKG** zu einem individuellen therapeutischen Vorgehen.
Im Stadium I/II wird bei hinreichender kardiopulmonaler Funktion zunächst eine Lobektomie empfohlen. Bei Läsionen ≤ 2 cm im äußeren Drittel des Parenchymmantels und
Komorbiditäten müssen keine Kontraindikation sein
Auch Menschen mit Autoimmunerkrankung können eine Immun- bzw. kombinierte Immunchemotherapie erhalten. Voraussetzung ist, dass sie sich in einem guten Allgemeinzustand (ECPG 0–1) befinden und die Grunderkrankung weder aktiv noch lebensbedrohlich ist. Auch eine kontrollierte Hepatitis B oder C sowie eine HIV-Infektion stellen per se kein Hindernis dar.
gesichertem N0-Status ist die anatomische Segmentresektion hinsichtlich der Heilungschancen der Lobektomie gleichzusetzen, sofern ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird.
Bei EGFR-Mutation auf Osimertinib setzen
Nach vollständiger Entfernung des Tumors sollte Erkrankten im Stadium IB und mit aktivierender EGFR-Mutation eine adjuvante Therapie mit dem Tyrosinkinasehemmer Osimertinib über drei Jahre angeboten werden. Selbiges gilt für Stadium II, unabhängig davon, ob eine vorherige adjuvante Chemotherapie möglich ist oder nicht. Liegt hingegen bei Tumorstadium II eine ALK-Translokation vor, sollte eine zweijährige adjuvante Therapie mit dem Tyrosinkinaseinhibitor Alectinib vorgeschlagen werden.
Liegt weder eine EGFR- noch eine ALK-Mutation vor, kommen im Stadium II monoklonale Antikörper ins Spiel. Patientinnen und Patienten mit einer PD-L1-Expression ≥ 50 % soll nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie eine Behandlung mit dem PD-L1-Inhibitor Atezolizumab über ein Jahr angeboten werden. Alternativ empfiehlt sich, unabhängig vom PD-L1-Status, eine Einjahrestherapie mit dem PD1-Inhibitor Pembrolizumab.
Auch im fortgeschrittenen NSCLC-Stadium IIIA mit EGFR-Mutation ist nach kompletter Resektion die Verabreichung von Osimertinib in Betracht zu ziehen. Die Behandlung erstreckt sich über drei Jahre und sollte nach einer adjuvanten Chemotherapie oder stattdessen gegeben werden. Im Stadium IIIA mit ALK-Translokation wird eine zweijährige Therapie mit Alectinib empfohlen. Bei fehlender EGFR- oder ALK-Alteration plädiert das Autorenteam der Leitlinie nach Operation und Chemotherapie wie im Stadium II für Atezolizumab oder Pembrolizumab.
Patientinnen und Patienten mit operablem Tumor können im Stadium IIIA im Rahmen der Induktion von einer kombinierten Immunchemotherapie profitieren. Sie eignet sich auch bei Erkrankten mit resektablem Karzinom und T3N2-Status.
Im Stadium IV soll bei typischer aktivierender EGFR-Mutation und ECOG 0–2 in der Erstlinie ein Tyrosinkinaseinhibitor angeboten werden, bevorzugt Osimertinib. Je nach Metastasierung kommt die Kombination mit einer Chemotherapie infrage. Die Behandlung kann auch bei schlechterer körperlicher Verfassung erwogen werden. Patientinnen und Patienten mit ALK-Translokation sollen in der Erstlinientherapie einen zugelassenen ZNS-wirksamen ALK-Inhibitor erhalten, bevorzugt Lorlatinib, alternativ Alectinib oder Brigatinib.
Wenn sich der Tumor als Plattenepithelkarzinom im Stadium IV und bei ECOG 2–3 manifestiert oder erst im Alter ≥ 70 Jahren auftritt, kann als palliative Primärtherapie die alleinige Behandlung mit Atezolizumab angeboten werden – unabhängig von PD-L1-Expression.
Applikationsdauer teils noch nicht geklärt
Die optimale Gesamtdauer der Immun- bzw. Immunchemotherapie im Stadium IV ist noch unklar. Die Checkpointinhibitoren Pembrolizumab und Cemiplimab wurden in den zulassungsrelevanten Studien über zwei Jahre verabreicht. Eine Verlängerung kann bei fortbestehender Tumorkontrolle und Verträglichkeit angeboten werden. Für Atezolizumab wurde in der Zulassungsstudie keine Begrenzung der Applikationsdauer festgelegt.
*Programmed Death-Ligand 1
**Deutsche Krebsgesellschaft
Quelle: S3-Leitlinie „Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms“, AWMF-Register-Nr. 020-007OL; www.awmf.org
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).