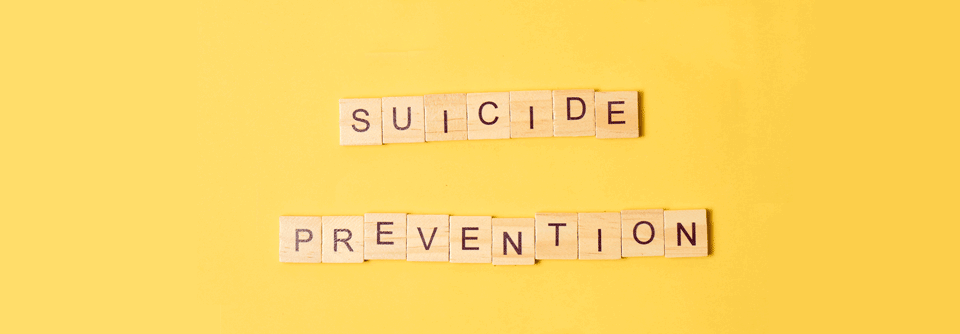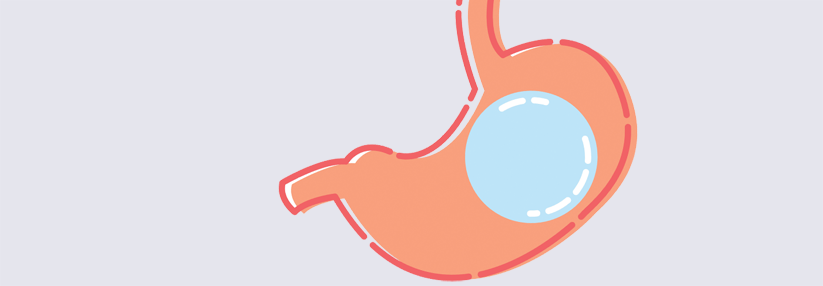„Eine sehr beglückende Erfahrung“
 Dass er allerdings mehr als vier Jahrzehnte lang an Inkretinhormonen forschen würde, war für den jungen Arzt damals noch nicht absehbar.
© zimmytws - stock.adobe.com
Dass er allerdings mehr als vier Jahrzehnte lang an Inkretinhormonen forschen würde, war für den jungen Arzt damals noch nicht absehbar.
© zimmytws - stock.adobe.com
Dass er seine fachärztliche Weiterbildung an einer Universitätsklinik absolvieren und dabei an wissenschaftlichen Projekten mitarbeiten möchte, stand für Professor Dr. Michael Nauck früh fest. Den Stoffwechselexperten, der heute die diabetologische Forschung im St. Josef-Hospital (Klinikum der Ruhr-Universität Bochum) leitet, verschlug es Anfang der 1980er-Jahre ans Uniklinikum Göttingen, wo Professor Dr. Werner Creutzfeldt ab 1964 eine Arbeitsgruppe für Inkretinforschung etabliert hatte. „Creutzfeldt hatte damals John Brown nach Göttingen eingeladen, der als Erster das Darmhormon GIP sequenziert hatte“, erinnert sich Prof. Nauck, „dieses Forschungsfeld fand ich sehr reizvoll.“
GIP: Zu Anfang gab es keine klinische Anwendung
Dass er allerdings mehr als vier Jahrzehnte lang an Inkretinhormonen forschen würde, war für den jungen Arzt damals noch nicht absehbar. In seinen ersten Projekten beschäftigte er sich vor allem mit dem Glukoseabhängigen insulinotropen Polypeptid (GIP). Und hierfür zeichnete sich zunächst keine klinische Anwendung ab: „Wir wussten, dass dieses Peptidhormon aus dem Darm bei Gesunden die Insulinausschüttung kräftig stimuliert. Etwa zwei Drittel der Insulinausschüttung nach dem Essen gehen auf das Konto der GIP“, erzählt Prof. Nauck. „Doch leider wirkt es eben nur bei Gesunden und nicht bei Menschen mit Diabetes.“
Therapeutische Perspektiven taten sich erst 1987 mit der Entdeckung des Glukagon-ähnlichen Peptid-1 (GLP1) und seiner Charakterisierung als Inkretinhormon auf. „Mit GLP1 mussten wir viele alte Fragen noch einmal neu stellen: Was ist seine physiologische Rolle? Wie wirkt es bei Typ-2-Diabetes?“, berichtet der Forscher. Tatsächlich konnte die Substanz zur großen Überraschung der Arbeitsgruppe – anders als GIP – auch bei Menschen mit Diabetes die Insulinausschüttung steigern: „Wir haben damals Patienten mit sehr hohen Blutzuckerwerten statt Insulin GLP1 verabreicht. Innerhalb von vier Stunden hatte sich ihr Blutzuckerspiegel normalisiert.“ Ein großes Hindernis war allerdings die geringe Halbwertszeit von GLP1. Die Substanz wird im Körper binnen weniger Minuten durch das Enzym Dipeptidylpeptidase 4 (DPP4) abgebaut und in der Niere eliminiert. Für einen therapeutischen Einsatz hätte es also einer kaum praktikablen kontinuierlichen Zufuhr bedurft.
Der nächste Durchbruch gelang mit der Entdeckung von Exendin-4, einem Peptid aus dem Speichel der nordamerikanischen Gila-Krustenechse – nahezu identisch mit GLP1, aber resistent gegen DPP4. Prof. Nauck erklärt: „Es ließ sich synthetisch herstellen, war leidlich verträglich und zeigte beeindruckende Effekte: Senkung des Blutzuckers und moderater Gewichtsverlust.“
GLP1: Die Pharma-Industrie war zunächst nicht interessiert
Während sich die akademische Forschung früh für GLP1 bzw. Exendin-4 interessierte, ließ das Engagement der Industrie zunächst auf sich warten. „Hintergrund waren Patentstreitigkeiten in den 1990er-Jahren“, erinnert sich Prof. Nauck. „Einer der Entdecker von GLP1 machte sehr weitreichende Ansprüche geltend, die alle Pharmafirmen zu hohen Lizenzzahlungen gezwungen hätten.“ Erst nach Klärung dieser Streitigkeiten nahm die Entwicklung um das Jahr 2000 herum an Fahrt auf.
Der Rest ist Medizingeschichte: 2009 wurde Liraglutid als erstes täglich zu injizierendes GLP1-Präparat zugelassen, gefolgt von den wöchentlichen Präparaten Dulaglutid bzw. Semaglutid und neuerdings auch dem dualen Agonisten Tirzepatid. Diese sind nicht nur als Antidiabetika, sondern auch als Medikamente zur Behandlung der Adipositas zugelassen.
Gewichtsabnahme: erst „nur ein kleiner Nebeneffekt“
„Die Gewichtsabnahme, die wir durch GLP1-RA bei Patienten beobachteten, war anfangs nur ein kleiner Nebeneffekt“, sagt Prof. Nauck. Unter Exenatid hätten Patient*innen im Schnitt etwa ein bis anderthalb Kilogramm Körpergewicht verloren. „Das ist aus heutiger Sicht nicht viel, doch im Vergleich zu Insulin, mit dem die Menschen dieselbe Menge zugenommen hätten, war es doch ein Erfolg.“ Mit den heutige GLP1-RA hingegen sind Gewichtsreduktionen von bis zu 15 Prozent des Körpergewichts realistisch. Damit ist eine Therapie von Übergewicht und all seiner Komplikationen möglich – von Herzinsuffizienz über die stoffwechselassoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) oder Schlafapnoe bis hin zu Gelenkverschleiß.
GLP1-RA punkten mit Kardioprotektion
Das breite Spektrum von Einsatzmöglichkeiten der Substanzklasse habe man damals nicht ansatzweise erahnen können, meint Prof. Nauck. In einzelnen Studien gab es zwar früh Hinweise auf eine kardioprotektive Wirkung: „Darin hatten Patienten eine dramatisch bessere Herzfunktion, wenn sie nach einem Herzinfarkt mit GLP1-RA behandelt wurden. Doch diese Ergebnisse hat – auch wegen der eher mäßigen Studienqualität – kaum jemand wirklich ernst genommen.“
Für die weitere Entwicklung in der Diabetologie erwies sich vor allem die AKKORD-Studie von 2008 als Glücksfall. Sie zeigte, dass eine aggressive Blutzuckersenkung das Risiko makrovaskulärer Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulär bedingten Tods wider Erwarten nicht senkt und stattdessen das Risiko gefährlicher Hypoglykämien erhöht. „Seither ist es Pflicht, in Zulassungsstudien für neue Diabetesmedikamente auch die kardiovaskuläre Sicherheit zu untersuchen“, berichtet der Experte. Und genau in diesem Aspekt konnten die GLP1-RA ein ums andere Mal punkten. „Diesen kardiovaskulären Outcome-Studien haben wir ungeheuer viel zu verdanken“, meint Prof. Nauck. Mittlerweile wird neben dem kardioprotektiven auch der nephroprotektive Effekt von GLP1-RA in eigenständigen Studien untersucht: „Mit GLP1-RA kann man nicht nur den Blutzucker senken und kardiovaskuläre Komplikationen vermeiden, sondern auch das Fortschreiten einer Nierenerkrankung in Richtung Dialyse hinauszögern.“
Zwiespalt, wenn es um „Abnehmspritzen“ geht
In der breiten Öffentlichkeit sind GLP1-RA aktuell allerdings fast ausschließlich wegen ihres Einflusses auf das Körpergewicht in den Schlagzeilen. Manch einem ist ein wenig mulmig bei dem Gedanken, dass nun „Abnehmspritzen“ vermehrt an die Stelle von Ernährungsumstellung und mehr Bewegung treten. Auch Prof. Nauck ist in dieser Frage durchaus zwiegespalten: „Natürlich gibt es mir ein ungutes Gefühl, wenn durch ungesunde Lebensumstände erst eine Pandemie des Übergewichts erzeugt wird und man diese Missstände dann mit Pharmaka wieder geradebiegen muss.“ Andererseits hat er großes Verständnis für Menschen mit Adipositas, die nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen endlich erfolgreich abnehmen möchten und sich für die medikamentöse Therapie entscheiden.
Gleichzeitig kritisiert er die weiterhin bestehenden Einschränkungen bei der Kostenerstattung, aufgrund derer es aktuell eine Frage des Geldbeutels ist, ob man Zugang zu GLP1-RA für die Adipositastherapie erhält: „Dass man hochwirksame Medikamente, die in bestimmten Situationen sogar lebensverlängernd wirken, grundsätzlich nicht zulasten der GKV verordnen kann, wird von namhaften Experten der Medizinethik als unethisch beurteilt“, mahnt Prof. Nauck.
Rückblickend sagt er: „Was mich persönlich betrifft, kann ich nur von Glück reden, dass ich als junger Assistenzarzt mit einem Projekt beginnen konnte, das mich so weit getragen hat. Das ist eine sehr beglückende Erfahrung, dass da so eine überwältigende Entwicklung stattgefunden hat. Sie hat mir eine Laufbahn ermöglicht, wie ich sie mir besser nicht hätte ausdenken können.“
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).