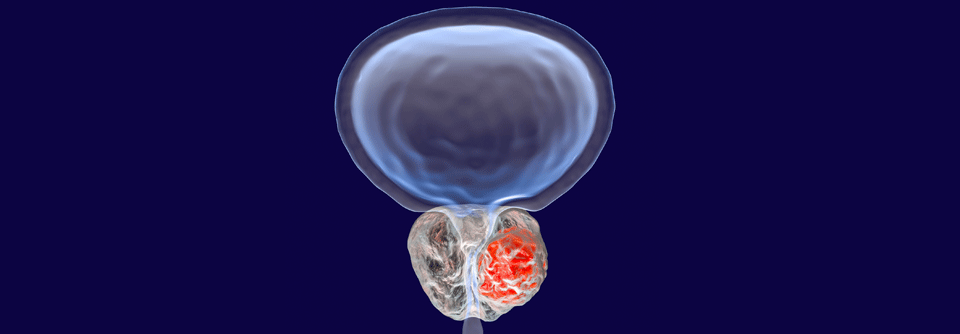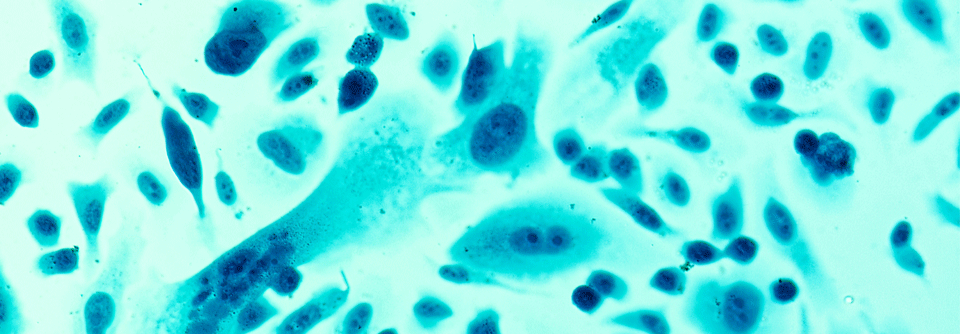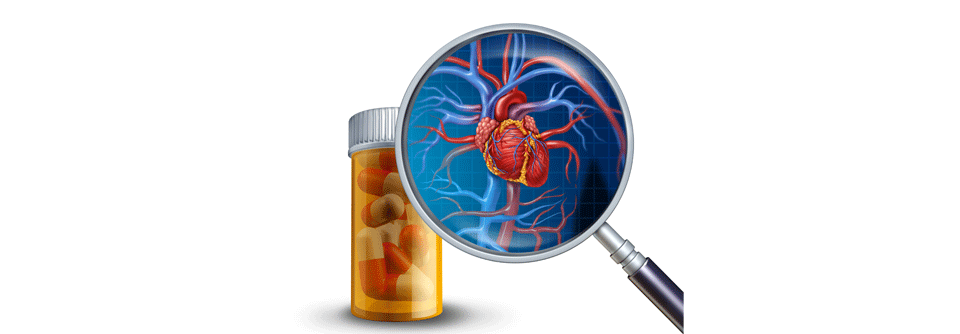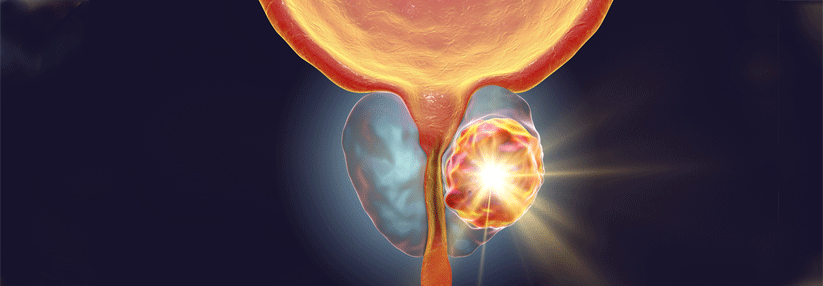
Früherkennung von Prostatakrebs individuell gestalten
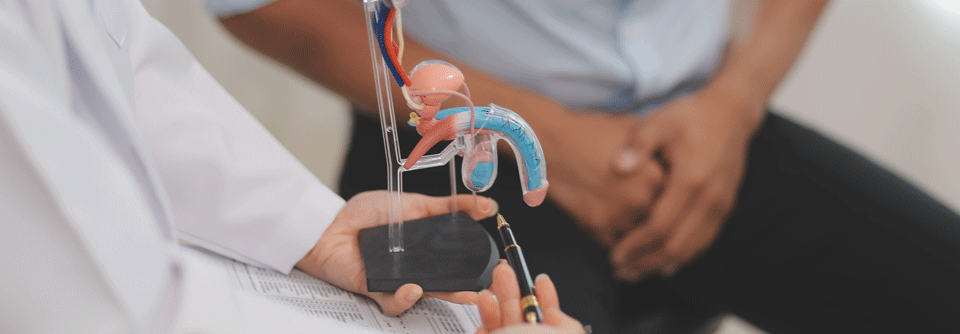 Das Prostatakarzinom ist das häufigste männliche Karzinom, mit stark steigenden Neuerkrankungszahlen prognostiziert.
© Kansuda – stock.adobe.com
Das Prostatakarzinom ist das häufigste männliche Karzinom, mit stark steigenden Neuerkrankungszahlen prognostiziert.
© Kansuda – stock.adobe.com
Personalisierte, risikoadaptierte Früherkennung
Das Dilemma des Prostatakarzinoms besteht darin, dass bei zunehmender Häufigkeit einer Prostatakarzinomdiagnose zwischen sog. klinisch indolenten Tumoren, die den Mann während seines Lebens nicht bedrohen werden, und solchen, die metastasieren, möglichst früh differenziert werden muss. Das heißt, die Anzahl an Überdiagnosen – also diagnostizierten Prostatakarzinomen, die weder klinisch auffällig geworden wären noch das Leben des Mannes verkürzt hätten – ist möglichst gering zu halten.
Überdiagnose lässt sich nicht gänzlich vermeiden. Aber durch eine individualisierte Früherkennung sowie Diagnostik kann Überdiagnose mit nachfolgender Übertherapie zumindest in Grenzen gehalten werden.
Basis-PSA-Wert
Über die Durchführung von Früherkennungsuntersuchungen sollte ergebnisoffen über Vor- und Nachteile beraten werden (siehe Tabelle 1). Falls eine Früherkennung gewünscht wird, sollte diese im Alter von 45 Jahren beginnen und ein Basiswert für das Prostata-spezifische Antigen (PSA) bestimmt werden. Mit einem Basis-PSA-Wert in diesem relativ jungen Alter können ca. 90 % der Männer für mindestens fünf Jahre die bisher empfohlenen jährlichen Früherkennungsuntersuchungen erspart werden. Der prädiktive Wert dieser Basis-PSA-Bestimmung ist erheblich, weil der Wert in diesem Alter nicht durch die Entwicklung einer gutartigen Prostatavergrößerung (BPH) kontaminiert und fälschlich erhöht ist. Durch die daraus resultierende Verringerung von Früherkennungstests wird die Anzahl sowohl falsch positiver Befunde (PSA-Wert auffällig, Abklärungsuntersuchung ohne Befund) als auch die der Überdiagnosen gesenkt.
Keine digito-rektale Untersuchung mehr
Die DRU ist seit über 50 Jahren Bestandteil der jährlich von den gesetzlichen Krankenkassen empfohlenen Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Sie hat nachgewiesenermaßen aber in der Früherkennung des Prostatakarzinoms eine zu geringe Sensitivität und Spezifität. Das heißt, die DRU führt sowohl zu inakzeptabel vielen falsch negativen Befunden als auch zu inakzeptabel vielen falsch positiven Befunden, deren weitere Abklärung wiederum mit Risiken verbunden ist (11).
Die DRU wird daher nicht mehr zur Prostatakarzinom-Früherkennung empfohlen.
Der neue PSA-MRT-Diagnose-Algorithmus
PSA-Werte von 3,0 ng/ml oder darüber definieren eine Hochrisikogruppe, für die eine Abklärung empfohlen wird (siehe Tabelle 2). Diese sollte mit einer Kontrolle des PSA-Wertes innerhalb von drei Monaten und einer Risikobestimmung (z. B. ERSPC – https://www.prostatecancer-riskcalculator.com, Cancer Research UK – https://prostatecanceruk.org/risk-checker) beginnen. Liegt der PSA-Wert auch in einer Kontrolluntersuchung über 3,0 ng/ml und ist nicht durch eine vergrößerte Drüse, eine akute Entzündung oder andere Einflussfaktoren erklärbar, wird eine Magnetresonanztomografie (MRT)-Bildgebung der Prostata empfohlen. Diese ersten Abklärungsschritte machen eine invasive Diagnostik mittels Biopsie bei der Hälfte der Männer mit zunächst auffälligem PSA-Wert unnötig. Männern mit familiärer Belastung (ein erstgradig Verwandter [Bruder, Vater] mit Prostatakarzinom und einem Diagnosealter < 60 Jahren oder mehr als ein erstgradig Verwandter) wird die gleiche Früherkennungsstrategie angeboten. Bei Männern mit einer genetischen Prädisposition (z. B. bei Nachweis von pathogenen Varianten im BRCA2-Gen oder den Lynch-Syndrom-assoziierten Genen MSH2 und MSH6) wird allerdings ein PSA-basiertes Screening bereits ab einem Alter von 40 Jahren empfohlen. Etliche randomisierte Studien (vor allem im Prostatascreening) zu diesem sog. PSA-MRT-Diagnose-Algorithmus (siehe Abbildung 1) zeigten, dass damit bis zu 70 % der Prostatabiopsien verhindert werden können. Hierfür ist sowohl die technische Qualität der MRT-Aufnahmen als auch die Erfahrung des Radiologen in der Befundung dieser MRTs entscheidend. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass die Befundung durch einen für die MRT der Prostata speziell zertifizierten Radiologen (Q2-Spezialzertifikat der Deutschen Röntgengesellschaft) erfolgt und die Durchführung entsprechend den aktuell gültigen Qualitätsstandards erfolgt.
Therapie des lokalisierten Prostatakarzinoms
Das lokalisierte, nicht metastasierte Prostatakarzinom der UICC-Stadien I und II (T1–T2c N0 M0) ist mit 68 % die häufigste Erstdiagnose des Prostatakarzinoms (www.rki.de). Neben der klinischen Stadienzuordnung wird das Prostatakarzinom nach Biopsie in verschiedene Graduierungsgruppen (GG) nach ISUP eingeteilt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche klinische Risikogruppen, die zur Sterblichkeit korreliert sind. Am gebräuchlichsten und besten validiert ist die NCCN (National Comprehensive Cancer Network)-Einteilung, die die alte sog. D’Amico-Risikoklassifikation ersetzt. Wichtig ist dabei die neue Unterteilung der großen Gruppe der Prostatakarzinome des intermediären Risikos, die nun auch therapeutische Konsequenzen hat.
Wegweisend für die neuen Therapieempfehlungen sind die gerade publizierten 15-Jahres-Daten der ProtecT-Studie aus England (F. Hamdy, NEJM 2024). Die klassischen Therapieformen – radikale Prostatektomie, Strahlentherapie und aktives Monitoring – wurden randomisiert miteinander verglichen, und es zeigte sich nach 15 Jahren kein Unterschied im krebsspezifischen Überleben (jeweils > 97 %). Patienten mit lokalisiertem Prostatakarzinom müssen daher neutral sowohl von Urologen als auch Strahlentherapeuten unter Berücksichtigung ihrer Komorbidität und Lebenserwartung über alle drei Therapieformen aufgeklärt werden. Niedrigrisikotumoren sollen aufgrund dieser Analyse überwacht und nicht sofort aktiv therapiert werden – und dies betrifft sicher die Hälfte der neu diagnostizierten Patienten mit Prostatakarzinom.
Aktive Überwachung
Die aktive Überwachung wird engmaschiger durchgeführt als in der ProtecT-Studie das „Active Monitoring“. Es wird empfohlen, eine aktive Überwachung nur mit einer den geltenden Qualitätskriterien entsprechenden MRT der Prostata und einer MRT-gestützten Biopsie zu beginnen, um eine Fehlklassifikation zu vermeiden. Das weitere Monitoring kann dann auch ohne Re-Biopsien, ausschließlich mit MRTs, erfolgen. Bei histologischem Progress, nicht jedoch bei alleinigem PSA-Anstieg, soll die aktive Überwachung zugunsten einer Operation oder Radiotherapie abgebrochen werden.
Radikale Prostatektomie
Die radikale Prostatektomie (RP) wird bei lokalisiertem Prostatakarzinom mit einer ISUP-Graduierungsgruppe > 2 oder Gruppe 2 mit ungünstigem Risikoprofil empfohlen. Roboterassistierte Operationstechniken zeigen in randomisierten Studien signifikante Vorteile hinsichtlich Frühkontinenz, kürzerer Hospitalisation und reduziertem Blutverlust. Eine sofortige adjuvante Bestrahlung wird nicht mehr generell, sondern nur noch bei High-Risk-Patienten empfohlen. Bei einem PSA-Rezidiv > 0,2 ng/ml nach kurativer Therapie sollte zunächst eine PSMA-PET-CT-Bildgebung zur Lokalisierung erfolgen, um gezielt z. B. bestrahlen zu können. Eine hormonablative Therapie sollte dabei so lange wie möglich vermieden werden.
Primär kurative Strahlentherapie
Die intensitätsmodulierte perkutane Strahlentherapie (IMRT) unter Einsatz bildgeführter Techniken (IGRT) stellt eine Alternative zur Operation dar – insbesondere bei älteren Patienten aufgrund der Spättoxizitäten. Bei intermediären und High-Risk-Patienten ist eine begleitende hormonablative Therapie obligat. Es besteht inzwischen gute Evidenz für eine hypofraktionierte Radiotherapie, also weniger Sitzungen: z. B. nur 5–7 Fraktionen innerhalb von 1–2 Wochen.
Oligometastasierte Patienten profitieren – neben der hormonablativen Kombinationstherapie (LH-RH-Analoga oder -Antagonisten + Androgenrezeptor-gerichtete Medikamente) – von einer gezielten Bestrahlung oder Operation des Primärtumors.
Genetisches Profil zur personalisierten Früherkennung und Therapie
Für das Prostatakarzinom sind inzwischen mindestens zehn relevante pathogene Keimbahnvarianten bekannt (z. B. BRCA1, BRCA2, CHEK2, TP53, ATM, PALB2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, HOXB13). Bei familiärer Anamnese – mindestens ein erstgradig Verwandter < 60 Jahre mit Prostatakarzinom – sollte ein genetisches Profil angeboten werden. Die deutschlandweit erste Risikosprechstunde PROFAM-RISK wurde mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe an der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Düsseldorf initiiert (profamrisk@med.uni-duesseldorf.de) und wird im Rahmen des ONCOnnect-Programms bald in mehreren onkologischen Spitzenzentren etabliert. Die Beratung umfasst eine ausführliche Anamnese, Genprofil-Analyse und eine MRT der Prostata. Auch bei bereits therapiertem oder metastasiertem Prostatakarzinom wird eine Keimbahngenetik und somatische Genanalyse im Gewebe empfohlen.
Quelle:
Vision Zero Magazin Nr.1/25
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).